

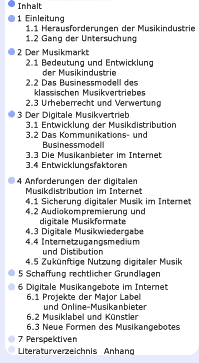
Neben den Technologischen Schutzmechanismen zur Sicherung des Musikvertriebs im Internet, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen den neuen Herausforderungen an die digitale Musik im Internet angepaßt werden. In diesem Sinne wird (seit Dezember 1997) an einer EU-Richtlinie, für die Anpassung der bestehenden WIPO-Verträge WCT (WIPO Copyright Treaty) und WPPT (WIPO Performance and Phonograms Treaty) an den Urheberrechtschutz in der Informationsgesellschaft, gearbeitet.
Die Musikindustrie hatte bisher die wirtschaftliche und rechtliche Hoheit über ihren Vertriebsweg. Dies ist im Internet nicht mehr möglich. Hier konkurrieren ihre Interessen mit den wirtschaftlichen Interessen der Technologieunternehmen, Netzbetreiber und Serviceanbieter. Die Musikindustrie besteht auf der Sicherung des Urheberrechts für die neuen digitalen Nutzungsarten, aufgrund eines alleinigen Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts beim Urheber und fordert die Mitverantwortlichkeit der Dienst-, Netz- und Hardwareanbieter für die Einhaltung dieses Rechts. Die Wirtschaft hingegen ist an einer sofortigen Nutzung von Musik im Internet interessiert und möchte hohe Aufwendungen für Schutzvorkehrungen und Mitverantwortlichkeit vermeiden. Manche Vertreter der Wirtschaft fordern gar gesetzliche Zwangslizenzen, die von den Tonträgerherstellern eingefordert werden können und die zur Eröffnung eines größeren Repertoires und zu einer schnelleren Erschließung des digitalen Musikvertriebs im Internet führen sollen. Entsprechend werfen Vertreter der Musikindustrie den Netzbetreibern ein Interesse an der Generierung von Netzverkehr durch ungeschützte Inhalte und ein Desinteresse an der Mitentwicklung von Schutzvorkehrungen und Filtern vor.
Die Forderungen an die neue EU-Richtlinie zur Erweiterung des Urheberschutzes in der Informationsgesellschaft ergeben sich im wesentlichen aus den neuen Nutzungs- und Verbreitungsmöglichkeiten digitaler Musikdaten und aus den Positionen der Musikindustrie, sowie der Netz- und der Hardwareanbieter. Ebenso darf aber auch die bestimmungsmäßige Nutzung der Musik durch den Konsumenten und dessen Recht nicht eingeschränkt werden. Während in Europa die entsprechende Rechtliche Grundlage im Jahre 2000 erwartet wird, wurde im Oktober 1998 in den USA der Digital Millenium Copyright Act (DMCA) als Erweiterung der in Kapitel 2.3.2 beschriebenen WIPO-Verträge verabschiedet. Nachfolgend seinen die Kernthemen der EU-Richtline dargestellt.
Zur wirksamen Sicherung von codierter und geschützten Musik müssen Technologien zur Umgehung von technischen Schutzsystemen gesetzlich untersagt werden. Dies betrifft Soft- und Hardwareprodukte, die eine Nutzung inhaltsgeschützter Musikdaten ermöglichen oder den Kopierschutz digitaler Musikdaten entfernen. Problematisch sind hier jedoch Produkte, die innerhalb ihrer Funktionsvielfalt eine Umgehung ermöglichen, dieses aber nicht ihre Hauptfunktion ist. Die angesprochene Resampling-Funktion von Computer-Soundkarten ist z.B. nicht primär zur Umgehung eines Musikschutzes, sondern im Funktionsumfang der Soundkartentreiber enthalten. Ebenso soll der Musikkonsument nicht in seinen Nutzungsrechten und -Möglichkeiten eingeschränkt werden, wenn er etwa gekaufte codierte Musik in das einheitliche Format seiner Musiksammlung umwandelt. Diesem privaten Nutzungsrecht, als Einschränkung des Urheberrechts in 2.3.1 beschrieben, soll nicht widersprochen werden.
Das Recht auf Musikkopien für den privaten Gebrauch wurde dem Käufer zugesprochen, als nur analog kopiert werden konnte. Die Vergütung erfolgte über die Leerkassetten und Geräteabgabe. Der Entwurf der EU-Richtlinie schlägt vor, zwischen digitalen und analogen Kopien zu unterscheiden. Digitale Vervielfältigung bietet Ansatzpunkte private Vervielfältigung zu kontrollieren und individuell die Rechteinhaber einer Musikaufnahme zu vergüten. Eine Gebühren- oder Abgabenregelung soll nur dort in Betracht kommen, wo durch technische Möglichkeiten vor Kopien nicht geschützt werden kann.
Die digitale Musikdistribution nutzt grenzüberschreitend die Dienste von Netzbetreibern und Serviceprovidern. Dieser Distributionsweg unterliegt nicht mehr dem Einfluß der Musikindustrie, so daß Rechtsverstöße und Mißbrauch nicht mehr direkt kontrolliert werden können. Urheberrechtsverletzungen von digitaler Musik können das illegale Vervielfältigen (Kopieren, Digitalisieren), illegale Veröffentlichen (Download, Streaming) oder das unerlaubte öffentliche Senden von Musik (Internet-Broadcast) sein. Mit der Regelung in § 5 TDG (Teledienste-Gesetz) hat der deutsche Gesetzgeber 1997 eine Regelung zur Verantwortlichkeit von Dienstanbietern und Netzbetreibern für die Übermittlung rechtswidriger Inhalte in Online-Diensten getroffen. Dienstanbieter, die fremde Inhalte zur Nutzung bereithalten, sind danach dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Da es sich bei Musikpiraterie um rechtswidrige Nutzung (den Verstoß gegen Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht) legaler Inhalte handelt, gilt es, so die Vertreter der Musikindustrie, die Verantwortlichkeit hier genauer festzulegen. Urheberrechtlich problematisch sind auch die technisch bedingten Vervielfältigungen beim Übertragungsprozeß innerhalb des Internet. Die Zwischenspeicherung von Dateien bei der Übertragung im Netz (Cachen) kann zu nachfolgender absichtlicher oder unabsichtlicher unvergüteter Nutzung von Musikdateien führen. Der DMCA nimmt hier die Serviceprovider mit in die Verantwortung und schreibt Regeln für die Verwaltung und Filterung der Caches vor. Die Musikindustrie sieht in der Kontrolle der Übermittlungswege die Möglichkeit zur Filterung illegaler Angebote im Internet. Im Hinblick auf unterschiedlichen Rechtsschutz in einzelnen Ländern und dadurch illegale Angebote im Ausland, wird so eine von der Herkunft illegaler Daten unabhängige Bekämpfung möglich.
Digitale Musik eröffnet neben dem Digitalem Musikvertrieb in Zukunft neue Verwertungsmöglichkeiten durch Internet-Radio (Broadcasting), digitalen Rundfunk und Near-On-Demand Dienste. Ausgenommen seien hier On-Demand-Diensten, die interaktiv auf Wunsch Musik abspielen. Near-On-Demand Dienste bezeichnen Mehrkanaldienste, die fortlaufend ohne redaktionelle Gestaltung Musik nach verschiedenen Stilrichtungen auf mehreren Kanälen digital anbieten. Auch besteht durch Internetbroadcasting und digitalen Rundfunk die Möglichkeit von vielen spezialisierten Spartensendern. Die verschiedenen digitalen Sendearten erlauben es, zusätzliche Informationen über die gespielte Musik innerhalb des Sendebetriebes zu übertragen. Durch vorheriger digitale Programmankündigungen wird es möglich, automatisiert gezielt Musiktitel auszuwählen. Die Sendung in digitaler Qualität wird vergleichbar mit der Distribution von Musik in digitaler Qualität und tritt damit als Konkurrenz für die traditionelle und digitale Musikdistribution auf. Dabei unterliegen digitale Sendungen, so wie der traditionelle Rundfunk, keiner Erlaubnispflicht der Rechteinhaber und zahlen eine Vergütung allein für das Senderecht. Die Musikindustrie strebt eine Änderung des traditionellen uneingeschränkten Senderechts an.
Problematisch für die Festlegung von wirksamen Gesetzen ist, im Spannungsfeld zwischen Schutz, wirtschaftlicher Innovation und persönlicher Freiheit der Konsumenten, allgemeine und langfristig gültige Regeln zu schaffen.
Wie schnell jedoch im Umfeld des sich schnell entwickelnden Mediums Internet neue, urheberrechtlich nicht abzusehende, Nutzungsmöglichkeiten entstehen, zeigt das Beispiel von Napster (www.napster.com) in den USA. Öffentliche Sendungen und öffentliche On-Demand-Dienste sind laut des DMCA erlaubnispflichtig. Eine private Musikvorführung von Musik unter persönliche Freunden ist nicht verboten. Napster schafft über das Internet persönliche Einzelbeziehungen zwischen zwei "Freunden" ihrer Community, woraufhin diese sich gegenseitig Musik auf ihrem Computer vorspielen. Es erfolgt keine Lieferung oder öffentliche Sendung durch Napster, sondern nur das Herstellen einer Beziehung. Der Teilnehmer wählt und hört sich die Musiksammlung seines persönlich über das Internet gefundenen Partners, eben auch über das Internet, an. Je nach Größe der Community entsteht ein umfangreiches und unentgeltlich zu nutzendes Musikrepertoire. Eine Einstellung des Service durch rechtliche Schritte waren bisher nicht möglich.
(Nachtrag des Autors: Im Januar 2001 wurde Napster durch Bertelsmann übernommen. Bertelsmann plant Napster zu einem Musikabonnementdienst umzuwandeln. Wieviele der Napster-User in Zukunft bereit sind, für den Musiktausch-Dienst zu zahlen ist fraglich.
Da der überwiegende Teil der getauschten Musikstücke urheberrechtlich
geschützt ist und für deren Verbreitung eine Verantwortung dem
verbreitenden Dienst mit anhaftet, hat schließlich im März
2001 die US-Recording Industry gerichtliche eine Einstellung der Musiktauschbörse
Napster erwirkt. Naster verspricht für die Zukunft einen Schutz zu
implementieren, so dass urheberechtlich geschützte Musikstücke
nicht mehr kostenlos austauschbar sind. )