

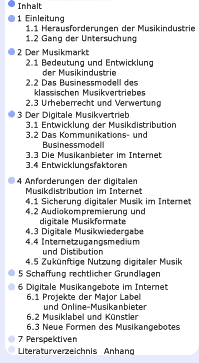
4 Anforderungen der digitalen Musikdistribution im Internet
Digitale Musik nimmt einen neuen Distributionsweg. Dieser ist im Gegensatz zum physischen Tonträgerverkauf nicht unter der Kontrolle der Musikindustrie. Die technischen Entwicklungen, das Interesse und die Verbreitung von digitaler Musik im Internet haben sich schneller entwickelt, wie geeignete Sicherungsverfahren etabliert werden konnten. Es gilt den neuen Vertriebsweg für Musik durch neue Standards im Interesse eines sicheren Musikvertriebes mitzugestalten und sichere Online-Distributionsysteme und digitale Musikformate zu entwickeln, die den Musikvertrieb im Internet erschließen und gleichzeitig unkontrollierte Weiterverbreitung wirksam verhindern können.
Nachfolgend werden zunächst die Technologien zur Sicherung von digitaler Musik dargestellt. Die bei der Musikdistribution verwendeten Musikformate und Kompressionsverfahren behandelt die Arbeit im Anschluß. Zur Nutzung digitaler Musik bedarf es neuer Wiedergabetechnologien. Deren Entwicklung wird in Kapitel 4.3 beschrieben. Die Entwicklung der Zugangstechnologien, die Grundlage für die digitale Übertragung, werden abschließen vorgestellt.
4.1 Sicherung digitaler Musik im Internet
Der Vorteil digitaler Musik ist, daß sie direkt zum Online-Käufer
über das Internet distribuiert werden kann. Zudem wird sie in einem
komprimierten Format übertragen und gespeichert. Genau diese beiden
Vorteile fördern aber auch eine einfache und unkontrollierbare illegale
Weitergabe der digitalen Musik vom Erstkäufer an weitere Nutzer.
Das Internet bietet dabei wieder die Plattform mit anderen Musiksammlern
zu kommunizieren, um weit über seinen sonstigen Freundeskreis hinaus
Musik auszutauschen.
4.1.1 Musikpiraterie
Die Musikindustrie rechnet weltweit mit Umsatzeinbußen von 5,3 Mrd. $ durch Musikpiraterie. Diese ergeben sich aus der klassischen Musikpiraterie, Internetpiraterie und Umsatzeinbußen durch private Vervielfältigung auf CD-R.
Die klassische Musikpiraterie ist die unrechtmäßige Herstellung und Vertrieb von Tonträgern. Dies können ohne Lizenzvereinbarung kopierte Titel, Plagiate von Tonträgern und Verpackung oder die Verbreitung unauthorisierter Musikmitschnitte (Bootlegs) sein. Der Umfang von unrechtmäßig hergestellten und vertriebenen Tonträgern weltweit, liegt jährlich bei etwa 2 Mrd. Stück, bzw. bei einem Anteil von 33% aller hergestellten Tonträger und ist besonders im ostasiatischen und russischen Raum sehr hoch. Je 70% aller Tonträger sind hier illegal. Nach Schätzungen der International Federation of Phonographic Press (IFPI) wurden 1998 400 Millionen Piraterie-CDs hergestellt, bei einem Zuwachs von 20%. Eine Verfolgung dieser Form der Musikpiraterie ist möglich durch Identifizierung der Herkunft einer CD, über einen eindeutigen ID-Schutzcode. Weltweit lassen sich etwa 80% der CD-Presswerke anhand dieser ID identifizieren und ermöglichen ein rechtliches Vorgehen in den jeweiligen Ländern.
Eine weitere Form der Musikpiraterie ergibt sich durch private CD-Brenner. Die Erstellung einer Kopie für die private Nutzung ist zunächst erlaubt, der Weiterverkauf oder das Verschenken einer Kopie nicht. Dies ist illegal. Mit sinkenden Preisen von CD-R und Brennern, könnten bald ähnliche Dimensionen, wie bei der klassischen Piraterie erreicht werden. Indikatoren für den starken Zuwachs dieser Form der Musikpiraterie sind Meldungen des Einzelhandels, speziell im Umfeld großer Schulen, über hohe Umsatzeinbußen. Eine genaue Zahl des Umfangs privater Kopien ist schwer zu ermitteln. Wurden, laut IFPI, etwa 10% der weltweit 1998 verkauften CD-Rs für Kopien von Audio-CDs verwendet, so sind 65 Millionen private Musikkopien erstellt worden. Besonders betroffen sind Europa, USA und Japan.
In einer 1997 von der IFPI durchgeführten Internetrecherche, wurden 2000 Musikseiten mit zirka 80.000 widerrechtlich angebotenen MP3-Dateien entdeckt. Innerhalb eines halben Jahres stieg das Angebot um 50%. Anfang 1999 wurde ein Anstieg auf 300.000 illegale Musik-Dateien mit monatlichem Zuwachs von ca. 70.000 neuen Dateien verzeichnet.
Von der im Internet angebotenen Musik sind etwa 90% illegale Angebote. Sie werden meist kurzzeitig auf öffentlich zugänglichen Internetservern abgelegt. Verweise auf diese illegale Musik befinden sich überwiegend in privaten Homepages auf öffentlichen anonymen Webcommunities oder werden in Internet-Chats mitgeteilt. Aber auch über Internet-Suchmaschinen lassen sich MP3-Musikdateien suchen, wie etwa mit mp3.lycos.com. Diese rechtfertigen ihr Suchangebot mit dem Vorhandensein von legal angebotenen freien MP3-Dateien. 1999 war der MP3-Suchbegriff eine der häufigsten Suchanfragen an Suchmaschinen im Internet.
Die Musikindustrie geht gegen die illegalen Musikseiten und deren Betreiber mit technischen und juristischen Mitteln vor. Mit Internet-Suchmaschinen, wie etwa der IFPI-Suchmaschine MUSICBOT, wird das Internet durchsucht. Daraufhin können die Webseiten-Betreiber der Webcommunities angemahnt werden, die illegalen Seiten von ihren Servern zu entfernen. In den USA setzt die Musikindustrie bereits 80% ihrer Anti-Piracy Resourcen für die Bekämpfung der illegalen Nutzung der neuen Technologien ein. Die Deutsche Landesgruppe der IFPI konnte 1998 in der ersten Jahreshälfte etwa 400 illegale MP3-Seiten schließen. Der neuen Form von Musikpiraterie ist es jedoch schwer nachzukommen, da die Anbieter schnell und grenzüberschreitend ihr Angebot verlagern, z.T. in Ländern mit einem geringen Urheberechtsschutz.
Wie noch in Kapitel 6 genauer dargestellt, bedarf es nationaler und internationaler Regelung, um im weltweiten Aktionsfeld die Internetpiraterie rechtlich zu bekämpfen. Neben dem rechtlichen Vorgehen gegen Musikpiraterie, gilt es für die Musikindustrie neue sichere Standards für Musik im Internet zu gestalten.
4.1.2 Initiative der Musikindustrie und Technologieunternehmen (SDMI)
Der De-facto Standard für die Musikverbreitung im Internet ist das MP3-Musikformat, für das bereits eine hohe Zahl von Software- und Hardwareprodukten erhältlich ist. Aufgrund seiner hohen Akzeptanz beim Konsumenten, besteht für die Musikindustrie die Gefahr, daß sich das MP3-Format für die Distribution von digitaler Musik in Zukunft etabliert. Denn für dieses Format existieren keine Möglichkeiten, seine Verbreitung zu kontrollieren, es vor unberechtigtem Kopieren zu oder die Inhaber der Rechte an einem Musikstück für deren Musiknutzung zu vergüten.
Im Dezember 1998 haben sich daher auf Initiative der Major Label, die Musikindustrie und Technologieanbieter in der Secure Digital Music Initiative (kurz: SDMI) zusammengeschlossen. Die SDMI hat das Ziel, die zukünftigen Entwicklungen für einen sicheren digitalen Musikvertrieb zu koordinieren und durch ein gemeinsames Engagement aller im Umfeld der digitalen Musik aktiven Unternehmen, einen neuen sicheren Musikstandard zu schaffen. Dieser soll das unsichere MP3-Format ablösen, eine weitere unkontrollierte Verbreitung von Musik verhindern und die Grundlage für die Entwicklung eines digitalen Musikmarktes im Internet bilden. Der SDMI gehören daher neben den Musikherstellern, den Majors und Independents, Netzbetreiber, IT-Unternehmen und Electronikhersteller, an.
Die SDMI hat nicht das Ziel, eine fertige zukünftige Technologie vorzugeben, sondern es sollen in gemeinschaftlichen Foren offene Standards für Schutzsysteme digitaler Musik geschaffen werden. In diesen Foren können die beteiligten Unternehmen bisherige Entwicklungen austauschen, harmonisieren und auf einen offenen SDMI-Standard hin abgleichen. Die Koordinierung der Entwicklungen aus den verschiedenen Technologiebereichen soll eine Vielzahl von proprietären Lösungen der Anbieter verhindert, da diese den Konsumenten verunsichern und eine Nutzung des unsicheren Standards MP3 weiter verstärken können.
Der SDMI gehörten im Dezember 1999 etwa 1000, mitunter konkurrierende Unternehmen an. Durch diese Größe ist die Entscheidungsfindung und Koordination von Standards langwierig, so daß einige Unternehmen weiter eigene proprietäre Lösungen entwickeln. Bis zum Juli 1999 wurde durch die SDMI ein offener Standard für portable Player veröffentlicht. Dieses sind tragbare digitale Wiedergabegeräte, mit denen bisher illegale und legale MP3-Musikdateien uneingeschränkt wiedergegeben werden konnten. Eine Beschreibung des SDMI-Standard für die portablen Player folgt in Kapitel 4.1.4.3. .
4.1.3 Anforderungen an sichere Musikstandards
Die Entwicklung eines sicheren Musikstandards wird durch die verschiedenen Anforderungen der Musikanbieter, Technologiehersteller und Musikkonsumenten bestimmt. Für eine Verbreitung einer Sicherungstechnologie und deren Unterstützung durch die Technologieunternehmen ist es vorteilhaft, offene Standards zu etablieren. Offene Systeme fördern neue, koordinierte und kontinuierliche Entwicklungen der Hersteller. Proprietäre Entwicklungen verunsichern Konsumenten und erhalten geringere Akzeptanz.
Der Musikkonsument ist an die einfache Nutzung des unsicheren MP3-Format gewöhnt. Damit neue Musikformate und ihre Sicherungstechnologien akzeptiert werden, sollen diese ebenso einfach, in gewohnter Weise und ohne zusätzliche Abläufe, die keinen unmittelbaren Mehrwert bedeuten, nutzbar sein.
Die Anforderung an eine Sicherungstechnologie ist daher einen hohen, aber für den Konsumenten transparenten Schutz für verschiedene Arten der Anwendung und Nutzung von digitaler Musik zu ermöglichen. Eine Sicherungstechnologie soll dabei auf den verschiedenen Plattformen der Musiknutzung, wie in Musiksoftware oder in Portablen Planern, implementiert werden können.
4.1.4 Technologien zur Sicherung digitaler Musikdaten
Zur Sicherung eines digitalen Musikdistributionssystems existieren vier
aufeinander aufbauende Technologiebereiche. Digitale Wasserzeichen markieren
digitale Musikdaten und liefern Information über die zulässige
Nutzung der distribuierten Musik. Verschlüsselungsverfahren bieten
eine Zugriffskontrolle auf die Musikdaten. Diese wird in Abhängigkeit
von der in einem digitalen Wasserzeichen beschriebenen Nutzungbedingungen
dem Empfänger der Musikdaten gewährt. Um digitale Musik außerhalb
des Computers zu nutzen, muß diese auf ein digitales Wiedergabegerät
und Speichermedium transferiert werden. Dabei sollen die Sicherungsmechanismen
durchgängig beibehalten werden und eine unberechtigte Verbreitung
mit anderen Speichermedien verhindert werden. Auf diesen grundlegenden
Technologien basierende Managementsysteme für die Überwachung
und Vergütung von digitaler Musiknutzung im Internet.
4.1.4.1 Digitale Wasserzeichen
Ein Digitales Wasserzeichen (engl. : Watermark) ist in einem Musiksignal versteckte Information, die bei ihrer normalen Nutzung bzw. bei der Musikwiedergabe nicht bemerkt wird. Sie werden vor der Musikdistribution über das Internet in die Musikdaten encodiert und können bei der Musiknutzung als zusätzliche Informationen ausgelesen werden:
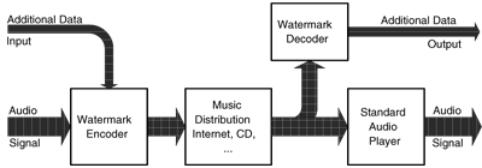
Abb. 12: Implementierung eines digitalen Wasserzeichens in ein Audiosignal
Quelle: entnommen Fraunhofer (1999).
Diese versteckten Informationen sind die Grundlage für den Einsatz weiterer Sicherungstechnologien. In Wasserzeichen können mehrere Arten von Informationen enthalten sein. Dies können Informationen über den Urheber der Musik, den Musikhersteller, den Musikanbieter oder Informationen über das Musikstück selber sein.
Das Wasserzeichen kann auch über die Nutzungsrechte der Musik Auskunft geben. Anhand des Wasserzeichens kann ein Benutzer dann erkennen, ob er Musik weitergeben darf und ob er illegale Musik erhalten hat. Neben der Information über den Musikanbieter der Musik können im Wasserzeichen die Käuferdaten, ähnlich einem persönlichen Fingerabdruck, mit encodiert werden. Dies schützt die Musik nicht vor einer unberechtigten Vervielfältigung, aber so kann der Urheber einer illegalen Verbreitung identifizieren und eine potentielle illegale Nutzung von Musik gehemmt werden.
Neben diesen Informationen bieten Wasserzeichen grundlegende Information, wie und unter welchen Bedingungen Verschlüsselungssysteme einen Zugang zur codierten Musik zulassen. Im Watermark kann festgelegt werden, wie oft ein Musikfile, bis zu welchem Datum genutzt, kopiert oder auf welchem Gerätetyp er abgespielt werden kann.
Eine Anforderung an ein digitales Wasserzeichen ist seine Robustheit gegen Löschversuche. Ein Wasserzeichen darf nicht durch Ausschneiden, Kopieren, Änderungen des Musikformates, analoges Überspielen oder Kompression der Musikdaten verloren gehen oder bewußt zerstört werden können. Wasserzeichen verteilen die Informationen in Bereiche der Musik, die durch das menschliche Gehör nicht wahrgenommen werden können. Die Daten des Wasserzeichens werden dabei durch eine Zeit-Frequenz-Modulation auf das gesamte Musiksignal und über das gesamte Frequenzspektrum der Musik verteilt. Wasserzeichen sind dann so mit den Musikdaten verknüpft sein, daß eine Entfernung oder Veränderung die Musik selber zerstört und somit Programme (Hacks) zur Entfernung eines Wasserzeichens nicht wirksam sind. Wasserzeichen bilden neben der Verschlüsselung von Musik einen zusätzlichen Schutz, der bestehen bleibt, selbst wenn die Verschlüsselung einer Musikdatei (etwa durch Hack-Programme) entfernt wurde.
4.1.4.2 Verschlüsselung und Zugangskontrolle
Die Grundüberlegung der Verschlüsselung und Zugangskontrolle ist es, festlegen zu können, wie und von wem die Musikdaten genutzt werden, die bei der digitalen Musikdistribution im Internet verbreitet werden. Mit Vorgaben aus dem Wasserzeichen, kann der Zugriff, z.B. gemäß einer bestimmten Nutzungsdauer, Häufigkeit oder nur mit einem bestimmten Gerät erlaubt werden.
Je nach Art der Nutzung der digitalen Musik und der sich daraus ergebenden
Sicherungsanforderung existieren verschiedene Sicherungs- und Distributionsmodelle.
Alle Sicherungsmodelle basieren zunächst auf einer Verschlüsselung
der mit einem Wasserzeichen versehenen Musikdaten. Es entsteht ein sicherer
Umschlag, der nur mit einem bei der Codierung generierten Schlüssel
wieder decodiert, bzw. geöffnet werden kann. Abbildung 13 zeigt die
Schritte die bei der Verschlüsselung von Musik durchgeführt
werden. Nach dem Einfügen des Wasserzeichens, wird die Musik komprimiert
und verschlüsselt, so daß ein sicherer Umschlag für die
Musikdistribution entsteht.
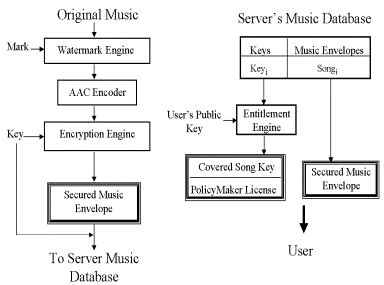
Abb. 13: Verschlüsselung und Distribution digitaler Musikdaten
Quelle: entnommen Lacy / Snyder / Maher (1999).
Die im Umschlag codierten Musikdaten werden zusammen mit ihrem Schlüssel
in einer Musikdatenbank gespeichert. Bei einem Musikkauf werden dem Käufer
der Schlüssel und der gesicherte Umschlag mit der digitalen Musik
dann getrennt zugesendet.
Der Musikkäufer hat nun mit dem Musik-Schlüssel, seiner Lizenz,
das Recht, die digitale Musik zu nutzen. Die verschlüsselte Musik
wird dabei nie decodiert und in einem unsicheren Musikformat abgespeichert.
Um die Musik anhören zu können, braucht der Käufer einen
Music-Player (Hard- oder Software), der mit Hilfe des Schlüssels
die Musik decodieren und abspielen kann. Der Player erlaubt keine Decodierung
und anschließende Speicherung der Musik in einem unverschlüsselten
Format.
Manche Sicherungs- und Distributionssystem verschlüsseln die Musik erst im Moment der Distribution, mit einen auf den Käufer registrierten privaten Schlüssel. Dadurch kann die Verwaltung der Musik-Schlüssel für jedes Musikstück beim Musikanbieter und Musikhörer eingespart werden. Vor der Codierung ist es für den Musikanbieter dabei dann noch möglich, Nutzungsbedingungen und Informationen über den Käufer im Wasserzeichen der Musikdatei zu integrieren. Dieses Sicherungsmodell benutzt z.B. Liquid Music von Liquid Audio.
Durch Nutzungsbestimmungen im Wasserzeichen können die Funktionen
des Music-Players genau bestimmt und gesteuert werden. Bei einigen Sicherungs-
und Distributionsmodellen erlaubt die Musik- und Sicherungssoftware, das
einmalige Brennen der Musikdaten auf eine Audio- CD-R oder erlaubt die
Möglichkeit, Musik auf einen portablen Player zu überspielen.
4.1.4.3 Portable Music Player
Die Nutzung von digitaler Musik ist nicht nur auf die Wiedergabe an einem Computer beschränkt. Ende 1998 wurden die ersten portablen Music Player angeboten, mit denen allerdings ausschließlich das ungesicherte MP3-Musikformat wiedergegeben werden konnte. Aus dem Internet geladene (illegalen oder legalen) MP3-Files und selbst von einer Audio-CD extrahierte Musik können in den MP3-Player übertragen und abgespielt werden. Die US-Musikindustrie, vertreten durch die RIAA, versuchte gerichtlich gegen diese portablen MP3-Player vorzugehen. Die RIAA argumentierte, daß diese MP3-Player als ungesicherte Aufnahmegeräte eine illegale Verbreitung von Musik fördern würden, war aber mit ihrer Klage nicht erfolgreich.
Den portablen Playern wird eine Schlüsselrolle für die Etablierung von digitaler Musik zugesprochen. Daher war eines der ersten Ziele der SDMI einen Standard für sichere portable Music Player zu entwickeln und zu veröffentlichen. Dieser wird als Grundlage für nachfolgende Sicherungs-Standards der SDMI gesehen. Die Anforderungen an diesen Standard sind, daß urheberrechtlich geschützte und illegal im Internet verbreitete Musik nicht mit den portablen Music Playern abgespielt werden kann. Gleichzeitig soll der Konsument aber weiter die Möglichkeit besitzen, legal im Internet verfügbare Musik und Musik von eigenen Audio-CDs zu übertragen und abzuspielen.
Für die Einführung des SDMI-Standards wurden zwei Phasen festgelegt. In Phase I wird lediglich auf einen Wasserzeichen-Schalter (Trigger) in der Musik geprüft. Bis zur Veröffentlichung eines einheitlichen Sicherungsstandards der SDMI in Phase II können alle Benutzer der portablen Music Player, wie bisher, ungesicherte und gesicherte Musikdaten aus dem Internet und von CD aufspielen. Seit Juli 1999 enthält jede neuveröffentlichte Musik ein Wasserzeichen mit Urheberinformationen, jedoch ohne aktivierten Trigger. Wenn ein einheitlicher SDMI- Sicherungsstandard verfügbar ist, wird in jeder neuen Musik dieser Trigger gesetzt. Will der Benutzer diese Musik auf seinen Player übertragen, muß er die Software des Players auf den neuen Phase II SDMI-Standard updaten, ansonsten verweigert die Software der Phase I einen Zugriff. Mit der neuen Software werden dann gleichzeitig die neuen SDMI-Sicherungsstandards für digitale Musik aufgespielt und eine Nutzung SDMI-verschlüsselter Musik ermöglicht. Legale freie Musik aus dem Internet und Musikveröffentlichungen vor Juli 1999 enthalten kein SDMI-Wasserzeichen und sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar. Unverschlüsselte Musikformate dürfen kein SDMI-Wasserzeichen enthalten. Musik von einer neuen Audio-CD enthält nach der Umwandlung in ein digitales Musikformat weiterhin das SDMI-Wasserzeichen. Sie kann daher als illegaler Musik identifiziert werden. Alle portablen Musik Player ab Dezember 1999 sind SDMI-kompatible und werden mit einer SDMI-Software der Phase I ausgeliefert.
4.1.5 Managementsysteme zur Verwaltung und Abrechnung digitaler Musikinhalte
Die vorgestellten Technologien zur Sicherung von digitalen Musikdaten basieren auf einer Zugriffskontrolle für Musik und auf Informationen im Wasserzeichen, welche die Nutzungsrechte beschreiben. Diese Informationen sind dabei fest und statisch in den Musikdaten integriert. Anhand dieser Informationen kann illegale Musik erkannt werden, eine nachträgliche Möglichkeit zur Authentisierung oder Lizensierung ist nicht gegeben. Ebenso können Urheberrechtsinformationen und Nutzungsrechte von einmal veröffentlichten Musikdaten beim Musikanbieter und Konsumenten nicht mehr variiert werden. Für die Verwaltung der Rechte von digitalen Daten existieren daher Managementtechnologien, die den Urhebern und Musikherstellern erlauben die Rechte an ihrer Musik flexible und dynamisch zu bestimmen: Digital Right Management Systeme.
Beim physischen territorial beschränkten Tonträgerverkauf sind Verkaufsrechte eindeutig und an die Zulieferung von Tonträgern durch die Tonträgerhersteller bestimmt. In digitalen Netzen ist eine Kontrolle der Verkäufe schwieriger und außerhalb der Urhebervereinbarungen und Vorgaben der Musikhersteller möglich. Innerhalb eines Digital Right Management übernehmen zentrale Vermittlungs- und Ausgleichsysteme zwischen Musikhersteller und Musikanbieter die Überwachung der Musikverkäufer und der finanziellen Ausgleiche. Dies sind die Clearhouse Systeme.
4.1.5.1 Digitale Right Management Systeme (DRM)
Digital Right Management-Technologien zur Verwaltung der digitalen Rechte von Musik im Internet (kurz: DRM ) erlauben es dem Urheber und Musikhersteller dynamische und flexible Nutzungsrechte von digitaler Musik zu bestimmen. Die aktuellen Rechte und Bedingungen werden dabei zentral im DRM-System gespeichert. Will ein Online-Musikanbieter eine bestimmte Musik in sein Angebot aufnehmen, kann er über ein DRM-System die Rechte für diese Musik abfragen und beantragen. Online-Musikanbieter erhalten die Möglichkeit, bei der Distribution und dem Musikverkauf an den Käufer, aktuell Informationen und Bedingungen abzurufen. Dadurch ist es für den Musikhersteller möglich, zentral für alle Online-Musikanbieter neue Vertriebsbedingungen, wie etwa Verkaufspreisänderungen, zu setzten. Ein neuer Online-Musikanbieter kann über ein DRM-System aktuelle Informationen über Nutzungsbedingungen und Vertriebsrechte beantragen.
Beim Einsatz eines DRM-Systemes werden im Wasserzeichen der Musikhersteller nur noch unveränderliche Informationen, wie Titelinformationen, Künstler und Urheber, sowie ein eindeutiger Code zur Identifizierung des Musikstückes abgelegt. In der Datenbank eines DRM-System werden der Code und die zugehörigen aktuellen Informationen und Nutzungbedingungen für das Musikstück abgelegt. Die Rechteinhaber des Musikstückes haben Zugriff auf diese Daten und können diese ändern. Wird nun ein Musikstück im Internet distribuiert, wird dieses wie beschrieben verschlüsselt und mit den aktuellen Bedingungen, die das DRM-System enthält, versehen. Je nach DRM-Technologie können die Nutzungsbedingungen im Wasserzeichen oder im Schlüssel abgelegt werden. Der Player des Käufers liest diese Informationen aus und gestaltet die Zugriffskontrolle auf die Musik und die Musiknutzung gemäß diesen Bedingungen:
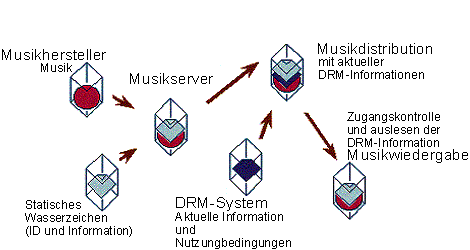
Abb. 14: Musikdistribution mit einem Digital Right Management - System
Quelle: in Anlehnung an Intertrust (1999).
Neben der Vorgabe aktueller Distributionsbedingungen, bestehen verschiedene Möglichkeiten, die spätere Nutzung der Musik durch den Konsumenten zu bestimmen. Es kann die Anzahl möglicher Kopien oder die Zahl weiterer Generationen von Kopien festgelegt werden. Es kann der Zeitraum oder ein Stichtag, bis oder wie lange der Musikfile angehört werden kann, bestimmt sein. Oder eine Häufigkeit, wie oft der Musikfile abgespielt werden kann, wird festgelegt. Darüber hinaus sind Kombinationen der Bedingungen möglich.
Durch diese variablen Nutzungsbedingungen sind alternative Businessmodelle für den Vertrieb von Musik und neue Chancen für die Promotion von Musik möglich. Die digitale Musikdistribution ist damit nicht mehr nur auf den Verkauf eines festen Musikformates festgelegt. Digital Right Systeme schaffen zudem eine Transparenz für Online-Musikanbieter und erleichtern die Distribution von Musik der verschiedenen Musikhersteller.
4.1.5.2 License and Financial Clearhouses
Beim Vertrieb von digitaler Musik muß sichergestellt werden können, daß der Musikhersteller und der Künstler für die verbreitete digitale Musik entlohnt werden. Digitale Musik läßt sich beliebig kopieren, so daß beim Tonträgerhersteller gegenüber dem Musikanbieter im Internet keine Kontrolle über Verkaufszahlen, wie beim physischen Tonträger besteht. Digital Right Management Systeme verwalten die Rechte von digitalen Daten im Internet. Clearhouse Systeme, innerhalb eines DRM-Systems, gewährleisten, daß der Musikhersteller jeden digitalen Musikverkauf kontrollieren kann, darüber informiert wird und mit dem Musikanbieter abrechnen kann. Neben License Clearhouse Systemen für die Verwaltung der Lizenzen und Kontrolle der digitalen Distribution, können für die Steuerung der finanziellen Ausgleiche zwischen Konsument, Musikanbieter, Musikhersteller und Urheber Finance Clearhouse Systeme eingesetzt werden.
Clearhouse Systeme unterteilen die Musikdistribution in die Instanzen Musikhersteller, Online-Musikanbieter, Musikserver und Konsument diese verwalten die zwischen ihnen ausgetauschten Informationsströme.
Der Online-Musikanbieter erhält dabei keinen direkten Zugriff auf
die von ihm angebotene Musik und liefert nicht selbst Musik an den Konsumenten.
Er präsentiert lediglich die Musikauswahl im Internet und initiiert
die weitere Musiklieferung.
Er hat nur eine Vermittlerfunktion. Die Musiklieferung und deren Abrechnung
wird über das Clearhousing System abgewickelt.
Die nachfolgende Abbildung 15 (Authentification and charging) beschreibt den Ablauf beim Musikvertrieb über eine Clearhouse System. Beim Musikvertrieb über ein Clearhousing System wird zunächst die Musik auf einem gesicherten Musikserver (in Abbildung 15: content server) abgelegt. Diese wird vom Musikhersteller (Recording company) mit einem Wasserzeichen versehen, daß die Urheberinformationen enthält und zur eindeutigen Identifizierung der Musik dient. Die Musik wird komprimiert und verschlüsselt. Der Musikanbieter erhält keinen direkten Zugriff auf die Musik des Musikservers. Er erhält, zur Vermarktung und Vorstellung der Musik, Hörproben (sample content). Der Musikanbieter bietet im Internet die Musik dem Konsumenten an, der anhand der Hörproben, die Musik auswählen kann. Ein Musikkauf durch den Konsumenten (consumer) wird vom Online-Musikanbieter dem Clearhouse System mitgeteilt (content request). Das Clearhouse System wickelt nun die weitere Distribution und die Bezahlung (Authentification and charging) ab, indem es den Kunden überprüft, den Kauf abrechnet und ihn für einen Zugriff auf die Musik auf dem Musikserver autorisiert (authorization). Der Musikkäufer erhält Zugriff auf die erworbenen Musikdaten (content for sale) auf dem Musikserver und den License-Schlüssel (key-data) für die erworbene Musik.
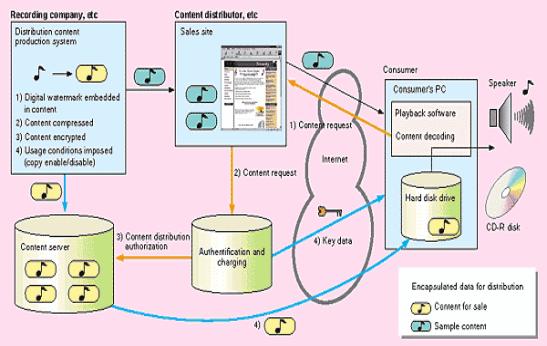
Abb.15: Ablauf der Musiktistribution über ein Clearhouse-System
Quelle: entnommen Takahashi / Yoshio (1999).
Bei der Autorisierung des Käufers, erfolgt gleichzeitig die Abrechnung
für den Musikkauf. Das Clearhouse System kann dann die finanzielle
Abwicklung und Verteilung der Einnahmen des Musikverkaufs übernehmen.
Die Rechte und Vergütungen für ein Musikstück sind auf
mehrere am Musikvertrieb beteiligte Instanzen verteilt. Die Vergütungen
werden beim physischen Tonträgerverkauf zu einem Teil schon vorher
gezahlt (z.B. Handel an Tonträgerhersteller, Tonträgerhersteller
an Musiker) oder zum Teil nach dem Verkauf ausgeschüttet (z.B. Musikeranteile,
GEMA an Urheber). Wenn an einem Musikstück mehrere Musiker beteiligt
sind oder eine Compilation mit Musik mehrerer Musikhersteller angeboten
werden soll, ist die Verteilung der Einnahmen aufwendig und langwierig.
Mit einem Clearhouse System können die Einnahmen aus dem Musikverkauf
automatisch verrechnet werden:
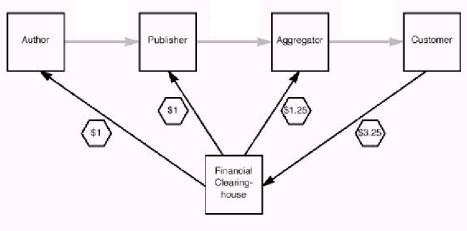
Abb. 16: Financial Clearhouse System zur Verteilung der Einnahmen aus
einem Musikkauf
Quelle: Intertrust (1999a).
4.1.5.3 Neue Anwendungs-und Distributionsmodelle für digitale Daten
Digital Right Management ermöglicht es, die Musiknutzung und Bedingungen eines Musikkaufes neu zu gestalten. Digitale Musik kann neben den Musikdaten weitere Informationen enthalten. Damit ist digitale Musik nicht nur eine Änderung des Tonträgerfomates, von einem körperlichen zu einem digitalen, unkörperlichen Format, sondern erlaubt eine Erweiterung der Anwendungs- und Distributionsmodelle für Musik.
Neben der Promotion von Musik über klassische Medien entstehen neue Verbreitungsmöglichkeiten für digitale Musik. Von erworbener digitaler Musik können vom Konsumenten eine festgelegte Zahl von Kopien erstellt werden, die an Freunde weitergegeben werden können. Ist die festgelegte Nutzungsperiode der Kopien abgelaufen, wird ihre Wiedergabe verweigert. Sie können dann über das Internet lizensiert werden und man erhält einen Schlüssel, mit dem die Musik unbegrenzt wiedergegeben werden kann. Eine zusätzliche Übertragung der Musikdaten ist nicht mehr nötig. Das Bedürfnis des Konsumenten, die Musik zu besitzen, wird dabei nicht über klassische Medien generiert, sondern über die Empfehlung eines Freundes. Die Konsumentenbeziehungen untereinander werden gleichzeitig als Distributionskanal genutzt. Das Kopieren und Weitergeben von Musik ist keine Bedrohung des Musikvertriebs mehr, sondern wird gezielt zur Vermarktung eingesetzt, unterstützt eine schnellere Verbreitung und Bekanntmachung der Musik.
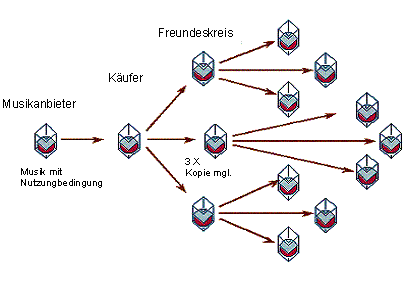
Abb. 17: Prinzip der Superdistribution
Quelle: entnommen Intertrust (1999).
Diese Form der Distribution wird als Superdistribution bezeichnet. Die Superdistribution ist ein Beispiel für den Einsatz eines Digital Right Management und möglicher Distributionsmodelle. Die Lizensierung jedes Käufers in der Distributionskette und die Verteilung der Einnahmen auf Künstler, Musikhersteller und Musikanbieter kann wieder über ein License und Financial Clearhouse abgewickelt werden.
Digital Rigth Management und Clearhouse Systems sind meist integrierte Systeme und werden als Service angeboten. Es existieren verschiedene Service-Anbieter, deren Digital Right Management Lösungen untereinander nicht kompatible sind. Die verschiedenen Lösungen verlangen unterschiedliche Konfigurationen beim Musikhersteller, Musikanbieter, sowie beim Musikkonsumenten. Welches System sich als Standard etablieren wird, ist u.a. von der Präferenz der Secure Digital Music Initiative für ein System abhängig. Bisher existieren Digital Right Management Systeme u.a. von Intertrust (Commerce), ARIS , IBM (EMMS), Liquid Audio (Liquid Music System), AT&T (Policy Maker) und NTT. Diese werden von verschiedenen Musik- und Technologiehersteller unterstützt und in Projekten getestet.
Die Verschlüsselung von Musik und die Verwendung von Digital Right
Management Systemen ist prinzipiell nicht auf ein bestimmtes digitales
Musikformat festgelegt.
Die Anbieter der DRM-Systeme favorisieren meist eigene Musikformate, die
auf das eigene Verschlüsselungsverfahren abgestimmt sind. Die Komprimierung
der verschiedenen DRM-Musikformate basiert dabei auf grundlegenden Komprimierungstechniken
für Musik. Die Komprimierungsverfahren und deren verschiedene digitale
Musikformate werden nachfolgend in 4.2 beschrieben.
4.2 Audiokomprimierung und digitale Musikformate
Zunächst werden Grundlagen der Digitalisierung und Komprimierung
dargestellt. Neben dem MPEG-1 Layer III Musikformat (bisher kurz MP3 genannt)
existieren alternative digitale Musikformate, deren Anforderungen, Eigenschaften
und Unterschiede im folgenden behandelt werden. Abschließend wird
ein Ausblick auf zukünftige digitale Musikformate und deren Möglichkeiten
gegeben.
4.2.1 Grundlagen der Digitalisierung und Komprimierung von Musik
Die Grundlage der Nutzung von Musik auf Computersystemen ist die Umwandlung
von Musik in digitale Musikdaten; die Digitalisierung. Musik oder ein
beliebiges anderes Audiosignal besteht aus einer durchgehenden (zeit-kontinuierlichen)
schwingenden Schallwelle mit beliebigen (analogen) Ausschlägen (Amplituden).
Bei der Digitalisierung wird das Signal der analogen zeit-kontinuierlichen
Musikwelle mit einer bestimmten Häufigkeit abgetastet (Abtastfrequenz)
und die analogen Werte im festen (diskreten) Abtastzeitpunkt festgehalten.
Ein analoger Abtastwert wird durch einen eindeutigen Wert aus einer festen
Skala von möglichen Werten angenähert (Quantisierung) und für
den Abtastzeitpunkt abgespeichert. Bei der Digitalisierung erhält
man so eine Datenfolge von zeit-diskreten und quantisierten Daten, die
hintereinander in einer Datei abgespeichert werden. Je nach Nutzungs-
und Qualitätsanforderungen an die digitale Musik können Abtastfrequenz
und Datenwerte variiert werden. Eine Audio-CD wird mit einer Frequenz
von 44100HZ abgetastet, wobei 216 Datenwerte (16bit) zur Annäherung
der Abtastwerte zur Verfügung stehen. Bei der Musikwiedergabe, werden
mit der gleichen Frequenz, wie die Abtastfrequenz, die einzelnen digitalen
Werte wieder in ein analoges Signal umgewandelt. Nach der Digitalisierung
ist die Musik in einem unkomprimierten rohem Musikformat vorhanden. Rohe
Musikformate sind z.B. das WAV- oder AIFF-Audioformat. Abbildung 18 zeigt
die Vergrößerungen eines einzelnen digitalisierten Tones (Ms
Windows ding.wav) mit den durch die Abtastung und Quantisierung entstandenen,
aber unhörbaren Treppenformen. Die beschriebene Digitalisierung von
Audiosignalen wird als Pulse-Code-Modulation (kurz.:PCM) bezeichnet.
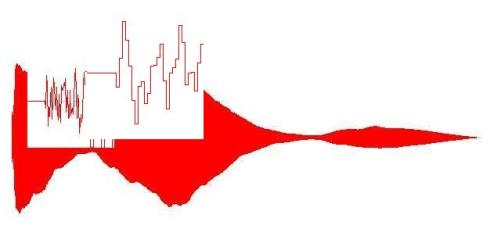
Abb. 18: Abtastung und Quantisierungsstufen (Ding.wav)
Bei der Komprimierung von Daten wird ihre Größe reduziert, indem ihre Informationen neu angeordnet, gruppiert und optimiert abgespeichert werden. Prinzipiell kann zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Komprimierung unterschieden werden. Die verlustfreie Komprimierung erlaubt eine Wiederherstellung identischer Informationen. Bei der verlustbehafteten Komprimierung gehen während der Komprimierung Informationen verloren. Streng genommen ist damit schon die Digitalisierung einer Audio-CD mit dem Verlust von Musik-Informationen gegenüber der Orginalmusik behaftet, da bei der Umwandlung der analogen Werte nur 216 digitale Werte zur Verfügung stehen und pro Sekunde nur 44100 mal ein analoger Musikwert erfaßt wird. Das menschliche Gehör ist in seinem Hörvermögen (auditive-perzeptuelle Fähigkeit) eingeschränkt und kann diese Unterschiede jedoch nicht wahrnehmen, so daß diese Werte an der Grenze des menschlichen auditiven-perzeptuellen Systems festgelegt wurden. Allerdings sind die Daten einer Audio-CD zu groß, um ihre Daten auf einem Computersystem zu speichern oder sie über das Internet zu übertragen. Eine Minute in CD-Qualität digitalisierte Musik benötigt etwa 10Mbyte, diese zu übertragen ca. 25 Minuten: Mit der Abtastete von 44100 mal pro Sekunde, werde beide Stereosignale und einem Quantisierungswert aus 216 (16bit) pro Minute 60 mal abgespeichert, dann mit einer Datenübertragungsrate von 56kbit übertragen:
44100 Abtastwerte/sec * 2 Sterokanäle * 16 bit = 1411200 bit/sec = 176400 byte/sec
Þ 176400 byte/sec * 60 sec/min = 10584000 byte/min ~ 10 MB pro Minute Musik
Þ 10584000 byte/min : 56 kbit/sec = 1477 sec ~ 25 min
Die Übertragung einer einzelnen Audio-CD mit 70 Minuten Spielzeit
hätte eine Datenmenge von ~700MB zu übertragen und würde
30 Stunden benötigen. Daher ist eine gute Komprimierung für
die digitale Musikübertragung elementar.
Die Komprimierungstechnik (kurz: Code = COdierung - DECodierung) aller
Musikformate basiert auf verlustbehafteter Komprimierung, unter Ausnutzung
der Einschränkung des menschlichen auditiven-perzeptuellen Systems.
Dies wird am Beispiel des MP3-Codec später noch detaillierter dargestellt.
Für ein Musikformat bzw. für seine zugrundeliegende Komprimierung bestehen verschiedene Anforderungen entsprechend ihrer Eignung für den digitalen Musikvertrieb. Die Hauptanforderung an einen Codec ist seine Komprimierungsqualität. Dies ist die Musikwiedergabequalität der Komprimierung, die an der Qualität der etablierten Audio-CD gemessen werden muß. Der Anspruch an die Musikqualität für den digitalen Musikvertrieb ist, daß die komprimierte digitale Musik keinen hörbaren Unterschied zur Audio - CD aufweist. Gleichzeitig muß ein Codec eine hohe Komprimierungsqualität im Bezug auf die Größe einer Musikdatei erreichen. Der Musikkonsument erwartet eine hohe Musikqualität bei möglichst schneller Übertragung der Musikdaten. Musik- und Komprimierungsqualität stehen allerdings im Gegensatz zueinander. Einer hohen Musikqualität stehen höhere Übertragungszeiten gegenüber. Eine kürzere Übertragung erfordert eine hohe Komprimierung, die mehr Musikinformationen entfernt und zu Qualitätseinbußen bei der Wiedergabe führt.
Es gibt Anwendungsformen von digitaler Musik, bei denen eine geringere Wiedergabequalität zu Gunsten der Übertragungsgeschwindigkeit heruntergesetzt werden kann. Dies kann etwa beim Vorhören von Testmusikstücken bei der Musikauswahl oder bei der Übertragung von Internet-Radio-Sendungen geschehen. Neben der Qualität unterscheiden sich Komprimierungsverfahren in der für ihre Kodierungs- und Decodierung erforderlichen Rechenleistungen. Gute Komprimierungsqualität erreichen einige Codecs durch rechenintensive und aufwenige Kodierung. Die Decodierung soll dabei auf einer möglichst großen Zahl, auch leistungsschwächeren PC-Systemen möglich sein.
Des weiteren bieten einige komprimierte Musikformate die Möglichkeit des Streamings. Beim Streaming muß nicht erst die gesamte Musikdatei geladen werden, sondern kann während des Ladevorgangs aus dem im Internet bereits angehört werden. Dabei können die mit Streaming übertragenen Musik- oder auch Videodaten direkt von einer aktuellen Live-Aufnahme (Live-Streaming) stammen. oder vorher gespeichert worden sein bevor sie übertragen werden. Beim Live-Streaming wird meist mit hohen Kompressionsraten gearbeitet, die eine kontinuierliche Übertragung der Daten zuläßt. Die Musikqualität nimmt dabei allerdings ab. Streaming kann für die Übertragung von Live-Konzerten, Internet-Radio, für promotionelle Musik oder für kurze Musikbeispiele beim digitalen Musikvertrieb verwendet werden.
Die verschiedenen Codecs haben unterschiedliche Wiedergabequalitäten, die z.T. von der komprimierten Musik selbst abhängen und schließlich auch von der persönlichen Wahrnehmung und Präferenz des Hörers bestimmt sind.
4.2.2 Audiokompressionsverfahren und Musikformate
Es existieren verschiedene Audiokompressionsverfahren, die jeweils auf unterschiedlichen Modellen der verlustbehafteten Kompression basieren. Dabei wurden die Audiokompressionsverfahren mit z.T. unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt. Nachfolgend werden verschiedene Audiokompressionsverfahren, ihre Einsatzmöglichkeiten und deren Eignung für den digitalen Musikvertrieb dargestellt. Ein Vergleich der Kompressionsverfahren wird in 3.4.4 durchgeführt.
4.2.2.1 Die MPEG und der Kompressionsstandard MPEG-1
Das Musikformat MP3 und sein Einfluß auf die Entwicklung der digitalen Musikverbreitung im Internet wurden bereits angesprochen. Bei dem MP3 Musikformat (genau: MPEG 1 Layer) handelt es sich um ein Audiokompressionsverfahren (kurz: MPEG). Die MPEG ist eine Standartisierungsorganisation der ISO/IEC (International Standarization Organisation / International Electrotechnical Commission). Ihre Aufgabe ist die Entwicklung internationaler Standards für die Verarbeitung, Kompression und Codierung von Video und Audio. Es existieren bisher die Standards MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4. Momentan weiterentwickelte und neue Standards sind MPEG-4 und MPEG-7. Die MPEG definiert dabei keinen festen Kompressionsalgorithmus, so daß Weiterentwicklungen und Anpassungen an eigene Bedürfnisse der Implementierung durch Nutzer der Standards erlaubt sind. MPEG-1 ist ein Standard für die Video- und Audiospeicherung, MPEG-2 ein digitaler Film- und Fernsehstandard, MPEG-4 ein Multimediastandard und MPEG-7 beschreibt einen Standard für die Repräsentation, Verarbeitung und Suche von Inhalten in multimedialen Daten. Innerhalb des Videostandards MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 beschreibt der MPEG Layer (I,II oder III ) jeweils den Grad der Komplexität des Audiostandards.
Die MPEG-Audiokompressionsstandards basieren auf wahrnehmungsabhängigen
Codierung (perceptual coding). Bei der Codierung wird nicht versucht,
daß orginale Musiksignal zu erhalten, sondern seine Reduktion der
Musikdaten durch die Kompression sollen für das menschliche Gehör
nicht wahrnehmbar sein. Für das menschliche Gehör wurde ein
psychoakustisches Modell entworfen, anhand dessen der Kompressionsstandard
entworfen wurde. Für die Komprimierung wird zunächst ein psychoakustischer
Effekt genutzt. Der Maskierungs-Effekt basiert auf der Grundlage, daß
Teile eines Musiksignals vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen
werden. Das Musiksignal wird daher in aufeinanderfolgende kurze Signalblöcke
eingeteilt und das Frequenzspektrum jeden Blocks mit einer Filterbank
in Freuquenzsubbänder unterteilt (in Abbildung. 19: mapping). Anhand
des psychoakustischen Modells werden innerhalb jeden Blocks zwischen den
einzelnen Freuquenzsubbänder der Maskierungs-Effekt des Gehörs
nachvollzogen und eine minimal wahrnehmbare Hörschwelle bestimmt
(psychoacoustic modell). Nicht wahrnehmbare Teile der Freuquenzsubbänder
eines Blocks können herausgefiltert werden. Beispielsweise können
sehr leise durch sehr laute Töne maskiert sein, die in ruhigeren
Passagen eines Musikstückes genau zu hören wären. Das menschliche
Wahrnehmungsspektrum (etwa 20HZ-30kHz) ist nicht linear, so daß
Töne im mittleren Frequenzbereich selbst lautere Töne aus Bereichen
am Rand des Spektrum überlagern können. Die gefilterten Daten
werden jetzt nicht blockweise, sondern über alle Blöcke hinweg
aus aufeinanderfolgenden gleichen Freuquenzsubbänder zusammengesetzt.
Diese Frequenzbänder über das gesamte Musiksignal werden quantisiert
und codiert.
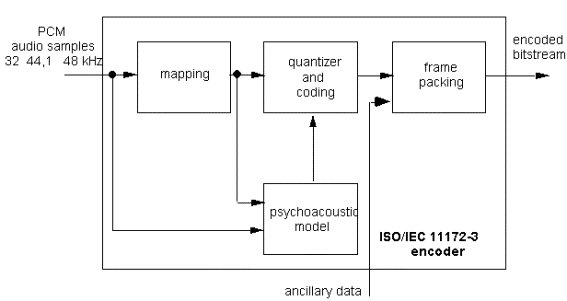
Abb. 19: Schema der Audiokomprimierung nach dem MPEG-1 Standard
Quelle: entnommen Mpeggroup (1999a).
Die Quantisierung und Codierung sind klassische aufeinander folgende Komprimierungsverfahren, bei denen die Datenmengen zusammengefaßt und gleiche Datenfolgen durch kürzere Codes ersetzt werden. Die Quantisierung und Codierung wird dadurch effektiver, da über gleiche Frequenzsubbänder hinweg zusammengefaßt wurde. Die Daten sind innerhalb gleicher Frequenzsubbänder ähnlicher und besser durch Quantisierung und Codierung komprimierbar. Schließlich werden die komprimierten Daten jedes Frequenzbandes wieder zusammengesetzt. Es entsteht wieder ein kompletter Frequenzbereich (frame packing), der in eine Datei (encoded bitstream) ausgegeben wird. Dabei können Musikinformationen der Datei hinzugefügt werden. Die Dekomprimierung bei der Wiedergabe ist weniger komplex. Das psychoakustische Modell oder eine Umgruppierung von Frequenzbändern ist nicht nötig. Die komprimierten Daten werden decodiert, indem die Codes aus der Quantisierung und Codierung wieder durch die assoziierten Datenfolgen ersetzt werden. Dies geschieht parallel für die Daten jedes Frequenzbands und kann bei der Musikwiedergabe geschehen. Die Genauigkeit und Qualität der Komprimierung wird durch die Zahl der Frequenzsubbänder und durch die Genauigkeit der Quantisierung bestimmt. Bei MPEG-1 ist die Zahl der Frequenzbänder auf 32 festgelegt worden. Die Parameter der Quantisierung können variiert werden, um zwischen höherer Musikqualität oder höherer Kompressionsqualität zu wählen.
MPEG-1 Layer I, Layer II und Layer III basieren auf diesem Kompressionsverfahren. Um etwa Musikqualität einer Audio-CD mit MPEG-1 zu erhalten, wird bei den verschiedenen Layern mit den in der folgenden Tabelle dargestellten Kompressionsraten gearbeitet. Die Kompression einer Musikdatei kann dabei auch durch die Datenrate, die für eine Wiedergabe der Musik nötig ist, beschrieben werden.
1:4 Layer I (entspricht 384 kbps für ein stereo signal),
1:6...1:8 Layer II (entspricht 256..192 kbps für ein stereo signal),
1:10...1:12 Layer III (entspricht 128..112 kbps für ein stereo signal),
Tab. 5: Kompressionsraten des MPEG-1 Standards zu Erreichung von CD-Musikqualitäts
Quelle: Fraunhofer (1999).
MPEG-1 Layer III und MPEG-2 werden nachfolgend, MPEG-4 und MPEG-7 im
späteren Ablauflauf der Arbeit behandelt.
4.2.2.2 MPEG-1 Layer III
MPEG-1 Layer I hat aufgrund seiner geringen Kompressionsraten und Musikqualität für den digitalen Musikvertrieb, keine Bedeutung. Layer II benötigt etwa die halbe Rechenleistung bei der Wiedergabe und findet daher Verwendung bei der Nutzung auf leistungsschwachen PCs (unter Pentium 90). Die Musikqualität mit einer Kompressionsrate von 1:8 (192kbs) komprimierter Musik ist vergleichbar mit 1:10 (128kbs) komprimierter Musik bei Layer III und hat 25% größeren Dateien und Übertragungsraten.
Die höhere Qualität der Kompression mit MPEG-1 Layer III wird
durch eine bessere MDCT-Quantisierung (Modified Discrete Cosine Transformation),
eine verbesserte Huffman-Codierung, und den Einsatz von zusätzlichen
Puffern, die sensible Musikpassage mit höheren Datenraten komprimieren,
erreicht. Zusätzlich kann Joint Stereo eingesetzt werden, daß
ähnlich, wie beim Prinzip von Subwoofersystemen, bestimmte Stereosignale
zusammenlegt, da deren räumliche Platzierung vom menschlichen Ohr
nicht wahrgenommen werden kann.
Die Implementierung des ISO-MPEG-1 Layer III Kompressionsstandards in
einem Codec wurde vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen
(Fraunhofer IIS) durchgeführt. Der Quellcode für den ISO-Codec
wurde veröffentlicht, ist aber nicht offen und frei in eigenen Produkten
zu integrieren. Durch die Zunahme der kommerziellen Verwertung des ISO-Codecs,
werden seit September 1998 vom Fraunhofer Institut für dessen Nutzung
Lizenzgebühren erhoben.
Aufgrund der Lizenzgebührenregelung wurden weitere MPEG-1 Layer III
- Codecs implementiert. Ein alternativer Implementierung ist beispielsweise
der XING-Codec von Xing Technlogy, der u.a. in der RealJukebox von Real
Networks verwendet wird. Er erlaubt eine schnellere Komprimierung, besitzt
jedoch eine geringere Musikqualität im Vergleich zum ISO- und einem
modifizierten Fraunhofer-Codec. Das Fraunhofer Institut ordnet die Musikqualität
des MPEG-1 Layer III - Codec für verschiedene Komprimierungsraten
folgendermaßen ein:
Qualität Bandbreite Modus Datenrate Kompression
Telefon 2.5 kHz Mono 8 Kaps * 96:1
Etwa Radio Kurzwelle 4.5 kHz Mono 16 Kaps 48:1
Etwa Radio AM 7.5 kHz mono 32 kbps 24:1
Vergleichbar Radio FM 11 kHz stereo 56...64 kbps 26...24:1
Annähernd CD 15 kHz stereo 96 kbps 16:1
CD >15 kHz stereo 112..128kbps 14..12:1
Tab. 6: Qualität der Mpeg - Komprimierung
Quelle: Fraunhofer (1999a).
Neben Musikinformationen können durch die Erweiterung ID3 des MPEG-1 Layer III - Standards zusätzliche Informationen im ID3-TAG am Ende der Musikdatei angehängt werden (Titel, Artist, Album, Jahr, Genre, Kommentare, Copyright, Komprimierungs- und Dateiinformationen):
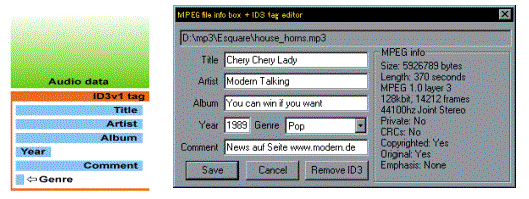
Abb.20 : ID3 Tag v1.0 - Aufbau und Darstellung (Nullsoft Winamp)
Quelle: ID3 (1999) und eigener Screenshot.
Der nachfolgende ID3 Version 2 Standard unterstützt die Integration längerer Texte, z.B. Songtexte. Der ID3 -TAG kann bei der Encodierung einer Audio-CD automatisch vom encodierenden Programm mit Hilfe z.B. der CD-Datenbank CDDB.COM im Internet (CD DataBase) ausgefüllt werden. Songtexte werden z.B. von search.lycics .ch zur automatischen Integration in den ID3v2-Tag angeboten.
MPEG-1 Layer III -Dateien können mit einem angepaßten Decoder, bereits während des Ladevorgangs aus dem Internet wiedergegeben werden (Streaming). Live-Streaming wird nicht unterstützt. Vorteile des MPEG-1 Layer III Kompressionsstandards sind seine hohe Verbreitung und damit die Unterstützung durch eine großen Zahl von Softwareanwendungen, Playern, Encodern oder durch Hardware, wie portable Player.
4.2.2.3 MPEG-2 AAC
Der MPEG-2 Standard wurde für die Übertragung und Speicherung von Film-, Video- und den mit diesen assoziierten Audiodaten entworfen. MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC) als Beschreibung der Audiokomprimierung des MPEG-2 Standards ist eine Weiterentwicklung des MPEG-1 Layer III Standards. Er wurde in Kooperation des Fraunhofer Institut mit Technologieunternehmen, wie AT&T, Philips, Sony oder Dolby entwickelt. Mpeg-2 AAC ist nicht mehr zu MPEG-1 kompatible und wird auch als MPEG-2 NBC (non backward kompatible) bezeichnet. Die Kompression wird durch zusätzliche Filter-, Quantisierungs- und Codierungstechnologien verfeinert und ist flexibler wie MPEG-1 Layer I, II, III gestaltet. Der AAC - Standard erlaubt bei der Kompression, je nach Anwendung, aus drei Profilen auszuwählen: Standard Profil (Main), LC mit geringer Komplexität, zum Einsatz auf leistungsschwächeren Systemen (Low Comlexity - LC) und ein SSR Profil (Scalable Sampling Rate, mit Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich geringer Datenraten und Leistung der einzusetzenden Systeme. Die Decodierung bei der Wiedergabe von AAC-codierter Musik benötigt bei Nutzung des Standard-Profiles etwa die doppelte Rechenleistung, wie ein Layer III Codec. AAC unterstützt dabei Bandbreiten des Audiosignals von 8kHZ bis 96kHZ, mono bis 48 Kanäle und kann für einen großen Bereich von Anwendungen eingesetzt werden. Digitales Radio, Mehrkanal - Cinema Sound in Kinos und auf DVD, bis zu bandbreitensensitiven Anwendungen, wie digitale Musik im Internet, können AAC nutzen. Dabei bietet AAC bessere Kompressionsraten für digitale Musik, wie MPEG-1 Layer III, bei gleicher Qualität. Mit AAC komprimierte Musik und einer Kompressionsrate von 16:1 (96 kbps) (Datenrate) entspricht in ihrer Musikqualität, etwa einer Layer III- Kompression (Datenrate) von 10:1 (128kpbs) oder Layer II Kompression (Datenrate) von 6:1 (192kbs).
Für den MPEG-2 AAC Standard existieren Hard- und Softwarelösungen. MPEG-2 AAC Hardware wird, z.B. in digitalen Radiostationen genutzt. Portable digitale Player unterstützen AAC bisher nicht, eine Formatkonvertierung in Layer III, ist zur Nutzung von AAC auf dem Portablen Player nötig. Für den AAC - Standard existieren, aufgrund seiner Komplexität, weniger Softwareimplementierungen, wie für den Layer III - Standard. Speziell kostenlose Decoder und Encoder sind wenig verbreitet, nutzen die Möglichkeiten des Standards nicht aus oder besitzen geringere Qualität, wie vergleichbare Layer III-Codecs. Die Musikanbieter A2B-Musik (www.a2bmusic.com) und Deutsche Telekom mit dem Music-on-Demand System (www.music-on-demand.com) benutzen je ein eigenes proprietäres verschlüsseltes Musikkomprimierungsformat auf Basis des MPEG-2 AAC-Standards. Ebenso nutzt Liquid Audio (www.liquidaudio.com) für ihre Digital Right Management -Lösung Liquid System ein eigenes proprietäres gesichertes Musikformat, mit Technologien aus AAC zusammen mit Technologien aus dem Kompressionsverfahren AC-3 von Dolby Laboratories. Das proprietäre Liquid Musikformat wird von einigen portablen Playern unterstützt (z.B. Kobelco, mpman). Je nach Implementierung der Decodierung kann Streaming unterstützt werden.
4.2.2.4 Windows Media Audio und Advanced Streaming Format
Im Mai 1999 hat Microsoft das Audioformat Windows Media Audio (WMA), früher als MS Audio bezeichnet, veröffentlicht. Windows Media Audio ist Bestandteil der Windows Media Technologie 4.0, die für Video-, Audio- und Sprachübertragung in Netzwerken entwickelt wurde. Die Windows Media Technologie 4.0 enthält verschiedene Kompressionsverfahren, die Bandbreiten von 10Mbs für Videoübertragung bis zu Bandbreiten von 5Kbps für Sprach- und Radioübertragungen im Internet ermöglichen. Windows Media Audio definiert die Audiocodierung und erlaubt Bandbreiten von 5kbps bis 128kbps bei einer Abtastfrequenz (Samplerate) von 8KHz bis 48KHz für Mono- und Stereosignale.
Das WMA - Format ist eine proprietäre Entwicklung von Microsoft. Informationen über die Kompressionstechnik wurden bisher nicht veröffentlicht. Allerdings sind von Microsoft Teile des Programmcodes für Decoder und Encoders zur Implementierung des Audioformates in eigene Programme verfügbar. Es existiert bisher verschiedene freie Encoder und Decoder für WMA, jedoch nicht in der Zahl und mit einer Funktionsvielfalt, wie für das offene MPEG-1 Layer III Musikformat. Laut einer Studie generiert der Windows Media Audio Encoder komprimierte Musikdateien in kürzerer Zeit und höherer Musikqualität, im Vergleich zum ISO-MPEG-1 Layer III Encoder.
WMA-Musikdateien erlauben die Wiedergabe während der Übertragung (Streaming), wenn sie in das Advanced Streaming Format (ASF) umgewandelt werden. ASF ist ein Bestandteil der Windows Media Technologie. Sie es erlaubt verschiedene Multimediaformate in das Advanced Streaming Format umzuwandeln und so direkt bei der Übertragung anzuzeigen oder wiederzugeben. Advanced Straming ist ein im MPEG-4 Standard integrierter Standard.
Mit Windows Media Format komprimierte Musik kann gesichert und verschlüsselt werden (Packaged WMA). Zur Verschlüsselung ist Microsoft´s Media Right Manager nötig, eine Digital Right Managment Lösung innerhalb der Media Technologie 4.0 . Die Wiedergabe von Packaged WMA ist mit speziellen Soft- und Hardwarplayern möglich. Bisher können Packaged WMA Musikdateien mit den portablen Playern von Diamond und Sony wiedergegeben werden. Darüber hinaus bieten bereits einige Musikanbieter Musik im Packaged WMA-Musikformat zum Verkauf an (z.B. bei Cdnow.com).
4.2.2.5 TwinVQ
Das Kompressionsverfahren TwinVQ wurde bei Human Interface Laboratories, einem Forschungsinstitut von NTT (Nippon Telephone & Telegraph) in Japan entwickelt.
TwinVQ (transform-domain weighted interleave vector quantization) ist
ein Kompressionsverfahren, daß ähnlich den MPEG Audiokompressionsverfahren
mit Hilfe eines psychoakustischen Modells arbeitet. Bei TwinVQ werden
die gefilterten Musikdaten jedoch mit einem anderen Verfahren quantisiert
und codiert. Die Daten werden dabei zunächst in Segmente von Mustern
(Vektoren) zusammengelegt. Jedes Muster wird mit vorher festgelegten Standardmustern
verglichen.
Das Standardmuster mit der größten Übereinstimmung wird
ausgewählt und das Muster durch die Nummer des Standardmusters im
komprimierten Code ersetzt. Die Genauigkeit und Qualität von TwinVQ
hängt dabei von der Größe der Segmente und Anzahl der
Standardmuster ab. Diese können zur Anpassung der Musikdatenrate
variiert werden.
TwinVQ generiert komprimierte Musikdateien, die 25% kleiner sind, wie MPEG-1 Layer III Dateien. Die Komprimierung dauert dabei allerdings bis zur dreifachen Zeit mit dem einzigen verfügbaren Yamaha/VQ Encoder . Sie erreicht eine Musikkomprimierung deren Musikqualität subjektiv, speziell für geringere Musikdatenraten unter 128kbs, über der von MPEG-1 Layer III liegt.
Yamaha hat TwinVQ lizensiert und für das Musikformat SoundVQ (VQF) einen Decoder und Encoder (Yamaha VQE /VQP) implementiert. Es existieren ansonsten wenige Implementierungen. Das SoundVQ - Musikformat wird von einigen digitalen portablen Playern (z.B. Solid Audio von Kobelco/Japan ) verwendet und ist im MPEG-4 neben AAC als Audiokomprimierungsstandard enthalten.
4.2.3 Vergleich der Audio Kompressionsverfahren
Die Eignung eines Kompressionsverfahren für den digitalen Musikvertrieb wird von der Musikqualität und Kompressionsqualität bestimmt. Die Musikqualität beim digitalen Musikvertrieb muß dabei an der Qualität einer Audio-CD gemessen werden. Bei einer geringeren Qualität der digitalen Musik wird der Konsument den digitalen Musikkauf nicht als Alternative zum klassischen Musikkauf annehmen. Für eine Verbreitung und Etablierung eines Formates beim Musikkäufer sind weitere quantitative Faktoren von Bedeutung. Diese umfassen den Vergleich von Dateigrößen der komprimierten Musik, Rechenleistung bei der Encodierung und Decodierung, Verfügbarkeit der Hard- und Softwareplayer und Bereitstellung von Angeboten in dem entsprechenden Musikformat.
4.2.3.1 Problem der qualitativen Bewertung
Alle vorgestellten Kompressionsverfahren sind verlustbehaftet und versuchen mit psychoakustischen Modellen das menschliche Hören, bzw. die Grenzen des menschlichen Hörvermögens für die Kompression auszunutzen. Dabei werden dynamische Filter eingesetzt und die gefilterten Musikdaten mit verschiedenen Algorithmen zusammengefaßt. Die psychoakustischen Modelle und Algorithmen besitzen unterschiedlichen Musikqualitätseigenschaften in bezug auf Kompressionsraten und verwendetes Musikmaterial. Im Vergleich zwischen Kompressionsverfahren kann für eine hohe Kompressionsrate ein Verfahren bessere Musikqualität erzeugen, während bei geringerer Kompression ein anderes Verfahren eine bessere Musikqualität aufweist. Darüber hinaus ist die Musikqualität der Kompressionsverfahren nichts für jedes Musikmaterial gleich. Es existieren Musikstücke, die sich gut komprimieren lassen, während andere Musikstücke nur geringe Kompression zulassen, um eine gute Musikqualität zu erreichen. Darüber hinaus existieren für ein Kompressionsverfahren meist verschiedene Implementierungen von Encodern.
Die Encoder können dabei weiterentwickelt und ihre Qualität verbessert werden, ohne das deren Decoder geändert werden müssen. Ein Vergleich von Kompressionsverfahren ist daher abhängig von der Implementierung des Encoders, der ausgewählten Musikstücke und schließlich von der subjektiven Bewertung der Musikhörer.
Ein technischer Vergleich zur Bewertung einer Musikqualität ist
nicht möglich.
Die verschiedenen Kompressionsverfahren und Encoder werden daher in Hörstudien
verglichen, in denen die Testpersonen, verschiedene komprimierte Musikstücke,
gegenüber dem Original einordnen müssen. Es existieren wenige
wissenschaftliche, unabhängige und neutrale Untersuchungen zwischen
den verschiedenen Kompressionsverfahren.
Nachfolgend werden die Ergebnisse von einer Vergleichsstudie für
die Kompressionsverfahren MPEG-1 Layer II, Layer III und MPEG-2 AAC dargestellt.
Über die Musikqualität von WMA und TwinVQ kann aufgrund fehlender
unabhängiger, wissenschaftlicher Vergleichsstudien keine Aussage
getroffen werden.
4.2.3.2 Vergleichsstudie der MPEG-Kompressionsverfahren
In einer wissenschaftliche Studie der MPEG wurden die Kompressionsverfahren MPEG-1 Layer II, Layer III und MPEG-2 AAC (Main, LC, SSR) miteinander verglichen.
Die Studie wurde mit 31 Versuchspersonen durchgeführt, die im Laufe der Studie 41 verschiedene Musikausschnitte mit dem originalen unkomprimierten Musikausschnitt verglichen haben. Die Testpersonen sollten dabei die Unterschiede zweier Musikausschnitte auf einer freien Skala von unmerklich (0), bemerkbar aber nicht störend, etwas störend, störend bis sehr störend (5) einordnen. Welcher der originale Musikausschnitt war, mußte durch die Testperson festgelegt werden. Das Ergebnis der Bewertung wurde für die verschiedenen Musikausschnitte und Codecs kumuliert zusammengefaßt.
Der MPEG-2 AAC Main Codec mit einer Musikdatenrate von 128kbps konnte
bei der Zusammenfassung aller Ergebnisse der Musikausschnitte die besten
Ergebnisse erreichen. Die AAC Main codierte Musik wurde, als annähernd
nicht von der originalen Musik unterscheidbar, eingeordnet.
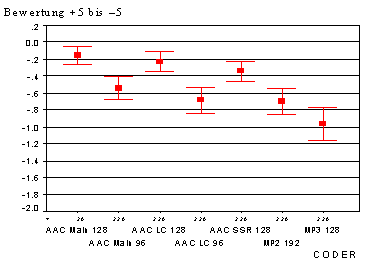
Abb. 21: Gesamtergebnisse der Vergleichsstudie
Quelle: Mpeggroup (1999c).
Die weitere Abstufung zeigt eine Präferenz der Testpersonen für
die weiteren AAC - Coder, MPEG1-Layer II bei 192 kbps und schließlich
MPEG-1 Layer III. Negative Werte zeigen eine richtige Einordnung des Originals
zur komprimierten Musik, positive Werte würden eine Präferenz
der Testpersonen für die komprimierte Musik innerhalb der Skala (0
bis 5) zeigen. Die horizontale Skala entspricht der Verteilung in der
95% der Testpersonen lagen.
Die Ergebnisse für verschiedene Musikausschnitte zeigen die unterschiedliche
Komprimierungsqualität in Abhängigkeit von der Musik. Die verwendeten
Ausschnitte enthielten ein typisches Spektrum von Tönen und Instrumenten
in Musik:
No. Name Beschreibung
1 Castanets Castanets
2 Harpsichord Harpsichord
3 Pitch Pipe Pitch Pipe
4 Glockenspiel Glockenspiel
5 Suzanne Vega Female vocal
6 Male German speech Male German speech
7 Tracy Chapman Female voice, Percussion, Synthesiser
8 Ornette Coleman Saxophone, Trumpet, Double bass, Cymbal
9 Accordion/Triangle Accordion and Triangle
10 Dire Straits Synthesiser, High-hat, Drums, Percussion
Tab. 7:Komprimierte Musik- und Audioausschnitte der Studie
Quelle: Mpeggroup (1999c).
Die Ergebnisse des MPEG-1 Layer III Codecs, bei 128kbps Musikdatenrate
zeigen, daß der überwiegende Teil der Musikausschnitte annähernd
unhörbar durch die Komprimierung verändert wurde. Bestimmte
Ausschnitte, wie Musikaufnahmen einer Pfeife, Harfe oder von Kastagnetten,
wurden als "etwas störend" bis "störend"
eingeordnet wurden.
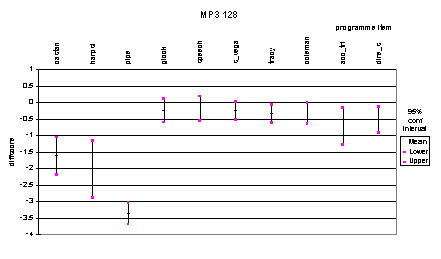
Abb.22: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-1 Layer
III
Quelle: Mpeggroup (1999c).
Ähnliche Ergebnisse zeigt der MPEG-1 Layer II Codec bei 192kbps für
die gleichen Musikausschnitte.
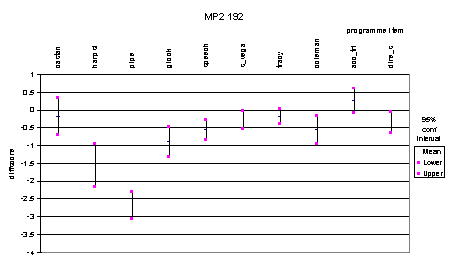
Abb. 23: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-1 Layer
II (192kbps)
Quelle: Mpeggroup (1999c).
Der MPEG-2 ACC Main Codec dagegen zeigt für alle Musikausschnitte
eine annähernd gleiche Einordnung der Musikqualität und wird
z.T. gegnüber dem Original bevorzugt (Tracy Chapman Musikausschnitt
-0.4 bis +0.5).
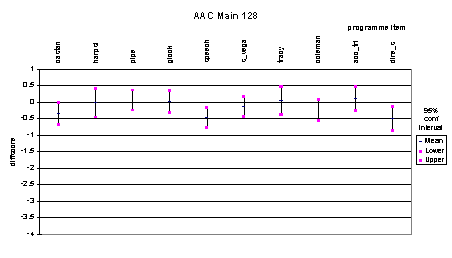
Abb. 24: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-2 ACC
Main (128kbps)
Quelle: Mpeggroup (1999c).
Zusammenfassend wurde bei der Studie eine Vergleichbarkeit von MPEG-1 Layer II bei 192kbs und Layer III 128kbs nachgewiesen. Dabei werden bestimmte Musikstücke nicht ohne wahrnehmbaren Qualitätsverlust komprimiert. Dies sind in der Studie Musikausschnitte mit Harfen- und Pfeifentönen. In anderen Musikstücken sind Unterschiede zwischen Original und komprimierter Musik weniger, bis kaum bemerkt worden. Die Unterschiede des Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC zum Original sind für alle Musikausschnitte nicht signifikant.
Die Studie kommt daher zu dem Ergebnis, daß das Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC, gegenüber dem MPEG-1 Kompressionsverfahren, für die Nutzung von Musikdatenraten von 128kbps bzw. 192kbps, subjektiv bessere Musikqualität bietet. Die mit AAC komprimierte Musik unterscheidet sich von der originalen Musikaufnahme nicht wahrnehmbar.
4.2.3.3 Resümee: Vergleich der Kompressionsverfahren
Für einen Vergleich der Kompressionsverfahren TwinVQ, Windows Media Audio und den MPEG Kompressionsverfahren existieren bisher keine ausschließlich wissenschaftlichen Studien.
Das Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC wird bisher für den digitalen Musikvertrieb von Liquid Audio, der Deutschen Telekom und a2b-Musik eine Kooperation mit AT&T verwendet. Cdnow bietet digitale Musik im Windows Media Audio - Format an. Zudem kooperiert Microsoft mit Sony und Diamond, die das Abspielen des WMA-Format auf deren portablen Playern ermöglichen. Ein Vorteil des WMA-Formates ist, daß Teile des Quellcodes des Encoders und Decoders für die Integration in eigene Softwareprodukte frei verfügbar sind. Quellcodes für AAC-Implementierungen sind nicht frei zugänglich. Es existieren nur wenige freie Encoder für AAC (z.B. Astrid/Quartex, Homboy AAC), die allerdings keine hohe Musikqualität aufweisen oder nur als Beta-Versionen verfügbar sind. Liquid Audio oder a2b-Music stellen keine freien Encoder für ihre Formate zur Verfügung. Der Musikhörer und Konsument kann daher nicht selbst Musik in diese Musikformate encodieren. Zudem benötigt man für die Wiedergabe proprietären Softwareplayer.
Welches digitale Musikformat sich als Standardformat für digitale Musik durchsetzten wird ist fraglich. Bisher hat die SDMI einen Standard für die Sicherung der portablen Musicplayer entwickelt, aber sich noch für kein Musikformat entschieden.
Ob der Musikkonsument wiederum bereit ist, ein neues sicheres Musikformat anzunehmen, wird u.a. von der Qualität, der Funktionsvielfalt und der Verfügbarkeit der zugehörigen Software und den Playern abhängen. MPEG-1 Layer III wird von einer Vielzahl von Programmen unterstützt. Es existieren viele Tools, die für andere Musikformate nicht existieren.
4.2.4 Zukünftige Multimedia- und Audiostandards
MPEG-4 ist ein Multimediastandard, der eine möglichst Große Zahl von Bild-, Audio- und Videoanwendungen unterstützen soll. Diese können dabei in Netzwerk-, Sende- (Broadcast-) oder Speichertechnologien verwendet werden. Daher sind im MPEG-4 Standard statische Bild-, MPEG-1, MPEG-2 und verschiedene Audio-Standards zusammengefaßt. Der MPEG-4 Standard ist skalierbar sein und ermöglicht aus verschiedenen Kompressionstechnologien für eine Anwendung zu wählen. Neben den dargestellten Komprimierungsverfahren, existieren neue Ansätze in MPEG-4, um in Zukunft Musik übertragen und zu speichern.
Ein Forschungsinhalt der MIT Media Lab Machine Listening Group ist Structured Audio. Structured Audio ist ein Komprimierungsverfahren, welches Musik über die Eigenschaften seiner Instrumente und deren Spielweise beschreibt. Klassische Audiokomprimierung reduziert die Daten durch psychoakustische Modelle und Komprimierung der Daten. Structured Audio beschreibt die Tongenerierung eines Instrumentes, so daß der Computer dessen Klangerzeugung virtuell modellieren kann. Sind alle Instrumente eines Musikstückes erzeugt (auf schnellen PC in Echtzeit), müssen nur die zu spielenden Noten (ähnlich einem Midi-Datenstrom) übertragen werden. Der Musikhörer hat nun die Möglichkeit, interaktiv in die Musik einzugreifen, Musikinstrumente auszutauschen, Effekte zu verteilen oder Instrumente und Noten verteilt von verschiedenen Ressourcen im Internet zusammenzustellen. Dies ermöglicht es, in die Musikwiedergabe interaktiv einzugreifen oder diese gezielt auf die Hörgegebenheit einzustellen, etwa um ungünstiger Akustik entgegenzuwirken.
Grundlagen von Structured Audio sind bereits im MPEG-4 Standard integriert. Im Hinblick auf einen digitalen Musikvertrieb ist es denkbar, das zukünftig verschiedene Inhalte (Instrumente, Soundalgorithmen, Noten, Texte) eines Musikstückes einzeln angeboten werden. Der Musikhörer stellt dabei seine Musik, nach Instrumenten selber zusammen, bzw. besitzt bereits einzelne Soundalgorithmen von virtuellen Instrumenten und kauft dazu die Noten oder Steuerinformationen. Die Structured Audio-Technologien kann das passive Hörerlebnis erweitern. "In Zukunft soll interaktive Musik den Hörer mehr mit einbeziehen, wie das heutige traditionelle Musikhören, um Hörern zu Teilnehmern und Co-Musikern zu machen".
Der MPEG-7 Standard definiert Möglichkeiten und Technologien, um im wachsenden Angebot von audio-visueller Information bestimmte Inhalte gezielt suchen zu können. Die erste Version von MPEG-7 soll im November 2000 veröffentlicht werden. Die Machine Listening Group im Media Lab des MIT entwickelt Möglichkeiten des "maschinellen Hörens" (Music Unterstanding Research, intelligent A&R Agents) für den zukünftigen MPEG-7 Standard. Neben technischen Ansätzen zur Analyse der Musik wird nach einer Möglichkeit zur automatischen Musikauswahl für den Hörer gesucht (intelligent A&R Agents).
Die Menge der zur Verfügung stehenden Musik wird immer größer
und unüberschaubarer, für die Musikanbieter, sowie für
den Konsumenten. Musikauswahl erscheint immer schwieriger und eher zufällig.
Viele Hörer wählen ihre Musik nach Trends und Empfehlungen von
etwa Radio, Freunden oder anderen Filtern aus. Diese basieren im traditionellen
Musikvertrieb auf der Vorauswahl der Artist & Repertoire Manager der
Labels. Diese Funktion sollen intelligente-Agenten im Internet erfüllen.
Ein Ziel der Untersuchungen ist es Musik in großen Musikarchiven,
wie die der Internetanbieter zu klassifizieren und nach Wünschen
und Vorlieben des Musikhörers durchsuchen zu können. Unterstützende
Filtersysteme und Intelligente Agenten sollen das Musikangebot im Internet
sortieren und eine Vorauswahl für den Musikhörer treffen. Hierbei
soll Musik maschinell analysiert werden, Inhalte erkannt, Stilarten unterschieden
oder Instrumente identifiziert werden. Die Intelligenten Agenten benutzen
verschiedene Technologien. Mit vorschlagsbasierter und kollaborativer
Filterung können Meinungen und Kritiken von Communities im Internet
zusammengeführt werden. Durch Aufbau einer Datenbank, die alle kollaborativen
Hörerinformationen über Musikstücke zusammenfügt,
entsteht eine Datenbasis, die gezielt nach den Bedürfnissen eines
Hörers ausgewertet werden kann.
Technische Ansätze vergleichen die Ähnlichkeiten von Musikstücken und versuchen eine automatische Einordnung. Es existieren Tools, die einzelne Musikinstrumente in Musikstücken, Noten und deren Taktgeschwindigkeit identifizieren. Die tatsächliche Attraktivität eines Musikstückes aus seinen Daten zu erfahren ist, nach Scherer (noch) nicht möglich.
Digitale Musik bedarf, wie bei der Einführung des neuen Formats CD,
einer neuen Generation von Abspielgeräten. Grundsätzlich kann
zwischen der Wiedergabe am Computer und der Wiedergabe über Digitale
Player unterschieden werden.
4.3.1 Computerwiedergabe digitaler Musik
Digitale Musik wird Online auf den Computer übertragen. Von hier kann sie sofort wiedergegeben werden. Nachteilig ist, daß die meisten Musikkonsumenten zwischen PC/Arbeitsbereich und Musikanlage/Wohnbereich trennen. Das Brennen der digitalen Musik auf CDR ist daher noch die Regel. Diese Trennung könnte in Zukunft durch die Verschmelzung von Telekommunikations-, Medien- und Computerausstattung im Home-Bereich aufgehoben werden. Die Vorteile der Computerwiedergabe, im Gegensatz zur CD, liegen in der hohen Funktionsvielfalt, neuen individuellen Nutzungsmöglichkeiten und der Möglichkeit von Zusatzinformationen. Neben etwa dem direkten Zugriff auf seine gesamte Musiksammlung, können beliebige Titelabfolgen z.B. nach Genre, Interpret oder Stimmung aus der Musikdatenbank auf dem PC automatisch zusammengestellt werden. Eine Digitale Musikdatei kann zusätzliche Informationen (Titelinformationen, Lyrics, etc.) oder Verweise für weitere Information (News, Video, etc.) im Internet enthalten, die beim Abspielen angezeigt werden. Die gespielte Musik kann, je nach verwendeter Playersoftware oder Zusatzprogrammen (Plugins) visualisiert, mit Effekten versehen oder interaktiv verändert werden. Die Musikwiedergabe am PC bietet im Vergleich zu Hifi - Equipment umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten ohne den Kauf teurer Zusatzgeräte.
Verbreitete Software-Musicplayer sind Winamp von Nullsoft und RealJukebox
von Realnetworks. Sie sind kostenlos im Internet erhältlich. Winamp
besaßen etwa 2 Mio. User im November 1999. RealJukebox von RealNetworks
mit über 2.2 Mio Downloads allein von Mai 1999 bis Juni 1999 ist
die am häufigsten eingesetzte Musik-Playersoftware . Die RealJukebox
unterstützt offene, sowie geschützte Musikformate und bietet
eine Verwaltung für deren Sicherungs-Schlüssel. Zudem wird dem
Musikkonsumenten über die Software ein direkter Zugang zu verschiedenen
Musikanbietern und der Kauf von verschlüsselter, sicherer Musikangeboten.

Abb. 25: RealJukebox Musikdatenbank und Player
4.3.2 Digitale Audioplayer
Die Verbreitung des Musikwiedergabegerätes ist maßgeblich für die Verbreitung eines Musikformates verantwortlich. Die zunehmende Ausstattung der Haushalte mit CD-Playern hat die Etablierung des CD-Formates unterstützt und dessen Erfolg mit begründet. Ähnlich verhält es sich mit der Etablierung der neuen digitalen Musikformate. Die Verfügbarkeit von Abspielgeräten und deren Kompatibilität mit den verschiedenen digitalen Musikformaten sind Voraussetzung zur Erreichung eines Massenmarktes und die Entwicklung der digitalen Musikdistribution. Während für die neue Technologie der digitalen CD nur ein neuer Gerätetyp, zunächst als Standgerät, dann als Portable und Car-CD-Player, nötig war, ermöglicht die digitale Musik eine neue Gerätegeneration mit einer Vielzahl von Endbenutzerformen. In der Anfangsphase ist die Musikwiedergabe über den Computer möglich. Um jedoch den Massenmarkt ansprechen zu können und Musik an den Orten der typischen Nutzung zu ermöglichen, ist eine neue Musikgerätegeneration nötig. Ein erster Schritt sind die walkman-ähnlichen PDM-Player (Portable Digital Music Player), wie etwa der seit 1998 erhältliche portable MP3-Player MP3Man von Saehan oder der RIO von Diamond. PDM-Player besitzen keine Mechanik und können Musikdaten in annähernder CD-Qualität von bis zu einer Stunde (bei 64MB) im eingebauten Memory oder auf austauschbaren Memory-Cards vom einem PC abspeichern. Diesen portablen Playern wird eine Schlüsselrolle für die Etablierung sicherer Standards und für Verbreitung digitaler Musik zugesprochen. Laut einer Forrester Research Analyse soll in den USA die Zahl der PDM-Player im Jahr 2003 auf über 30Millionen Geräte ansteigen, was einen positiven Effekt auf den digitalen Musikvertrieb haben soll.
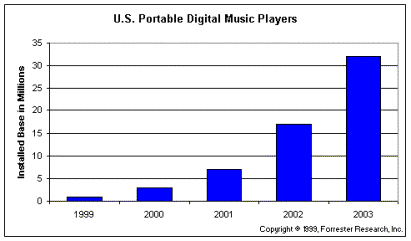
Abb. 26: Prognostizierte Verbreitung der Portable Music Player in USA
Quelle: entnommen Chun, (1999).
Die Popularisierung der PDM-Player ist im wesentlich vom Preis, speicherbarer Musiklänge und von der Zahl der unterstützen digitalen Musikformate abhängig. Die preisliche Entwicklung der Player ist eng an die Kosten des Speichermediums gebunden. Eine Erhöhung der Musikdauer ist nur durch mehr (und teuren) Speicher oder eine Absenkung der Klangqualität möglich. Der Wechsel von Musik ist ebenfalls nur mit Hilfe noch teurer FlashMemory-Cards oder an einem Computer möglich. Bei sinkenden Preisen könnten Mini-Festplatten im Kartenformat (wie etwa die IBM MiniDrive-Card mit 340MB für $400) Musikspeicher ersetzen. Geräte, die ausschließlich prorietärer, aber sicherer Musikformate einzelner Hersteller unterstützen, werden beim Konsumenten schwerer angenommen werden. Die Bestrebungen der SDMI zur Etablierung eines sicheren PDM-Player-Standards wurde bereits dargestellt. Mit Etablierung fester Standards für sichere Musikformate, ist mit einer Vielzahl neuer digitaler Musik-Player zu rechnen.
Neben den PDM-Playern werden seit Ende 1999 Standgeräte zur Integration
in die Hifi-Anlage (z.B. der M3Po CD-Harddisc-Player von Terratec, www.terratec.de)
und die ersten digitalen Car-CD-Player angeboten (z.B.empeg-car von empeg.com).
Diese Geräte verfügen über eine Festplatte und ein CD-Laufwerk,
um die Musikdaten aufzuspielen. Ebenso können einige mit ausreichend
Speicher ausgerüsteten Palm-Computer bereits Musik wiedergeben (
z.B. HP´s Jornado, www.hp.com/jornada).
Ein von Sony´s geplanter PDM-Player in Form einer klassischen Musikkassette,
soll auch über einen Kassettenrecorder Musik wiedergeben können
und zwischen digitaler und analogen Musiktechnik vermitteln. Ein weiterer
Entwicklungsschritt sind Geräte, die den Medienbruch durch das Überspielen
mittels CD-Technologie vermeiden und direkt Musik über einen eingebauten
Netzwerk/Internetanschluß einladen (z.B. der Brujo von NetDrive,
http://www.netdrives.com). Die Entwicklung zukünftiger Internet-Geräte
wird auf die Verwendung und auf die Verbreitung digitaler Musik Einfluß
nehmen. Dies können Settop-Boxen sein oder leistungsfähige Spieleconsolen,
die mit Modem ausgerüstet (z.B. Dreamcast von SEGA als erste Console
mit eingebautem Internetbrowser, www.dreamcast.com), Musik aus dem Netz
laden und abspielen.
Zusammenfassend betrachtet wird digitale Musik mit zunächst ähnlichen Wiedergabegeräten wie klassische Tonträger konsumiert werden und sie eröffnet gleichzeitig die Möglichkeiten für neuen Nutzungsformen und neue Wiedergabegeräte, welche die digitale Musikwiedergabe als Mehrwert integriert haben. Eine mögliche zukünftige Entwicklung der Nutzung digitaler Musik wird auch von der zukünftigen Bereitstellung des Internetzugangs abhängig sein. Diese wird im folgenden Kapitel dargestellt werden.
4.4 Internetzugangsmedium und Distribution
Neben den Anschaffungskosten für die Hardwareasstattung für
PC und CD-Brenner fallen bei der digitalen Musikdistribution Kommunikationskosten
im Vergleich zum Kauf physischer Tonträger an. Die Kosten des Online-Zuganges
sind als ein Anteil des Kaufpreises der digitalen Musik zu sehen. Sie
setzen sich aus den Grundkosten für den Zugang und aus den zeitabhängigen
Online-Kosten zusammen. Die Zeit für die Übertragung der Musikdaten
hängt von der Bandbreite des Internetzugangsmediums des Konsumenten
ab. Diese ist momentan überwiegend ein analoger Telefonanschluß
oder eine ISDN-Zugang mit Bandbreiten von 56kbps bzw. 64kbps. Die Übertragung
eines 5 minutiges Musikstück mit einer Komprimierung von 128kbps,
dauert somit 11,4 bzw. 10 Minuten. Die Übertragung einer 70 minütlichen
Musik-CD würde 156 bzw. 140 Minuten dauern. Bei momentanen 3-5 Pf
Providerkosten pro Online-Minute (Stand November 1999), fallen dementsprechend
beim Kauf einer digitalen Musik-CD reine Kommunikationskosten von 4,70DM
bis 7,80DM für einen analogen Zugang bzw. 4,20DM bis 7,00DM für
einen ISDN-Zugang an.
Die Aufschlüsselung der Verkaufserlöse einer CD in 2.2.3 zeigt,
daß etwa 10,50DM auf den Handel und etwa 2,50DM auf die CD-Produktion
entfallen. Diese Kosten können zwar beim Anbieter digitaler Musik
eingespart werden, doch fallen indirekt Kommunikationskosten beim Konsumenten
neben dem angebotenen Verkaufspreis an.
Für digitale Musik wird der Konsument einen vergleichbaren Verkaufpreis
erwarten. Die zukünftigen Bandbreiten und Technologien, sowie die
zukünftigen Kosten des Internetzugangs haben daher einen wesentlichen
Einfluß auf die Entwicklung der digitalen Musikdistribution.
Technologien, die einen Zugang zum Internet mit höheren Bandbreiten
erlauben, sind xDSL, Richtfunkanbindung, Satellit oder Internetzugang
über Digitale Kabelmodems. Nachfolgend sollen kurz die verschiedenen
Technologien vorgestellt werden, um eine Abschätzung zukünftiger
Bandbreiten für den privaten Internetzugang des Musikkäufers
abschätzen zu können.
xDSL (Digital Subscriber Line) nutzt weiterhin die analoge Telefonleitung
zum Kunden. xDSL beschreibt die Grundlagentechnologie für weiter
und zukünftige Entwicklungen (z.B. ISDN, ADSL, SDSL, HDSL). ADSL
wird unter dem Namen T-DSL von der Deutschen Telekom in Deutschland angeboten
und ermöglicht Bandbreiten von etwa 750 kbps an einem Privatkundenanschluß
. Die xDSL-Technologie befindet sich in ständiger Entwicklung und
Bandbreiten der Technologie bis 7 Mbit/s bereits möglich. Beim Internetzugang
über eine Funkanbindung werden der Endbenutzer oder mehrere Endnutzer
eines Gebäudes per Richtfunk ein Internetzugang zur Verfügung
gestellt. Dabei sind z.Z. Bandbreiten um 10Mbit/s. Bei der Anbindung der
Haushalte über Satellit sind Datenraten bis 4 Mbit/s möglich.
Dabei empfängt der Internet-User die Daten per Satellit und forderte
Daten über eine terrestrische Leitung mit einer niedrigeren Datenrate,
als Rückkanal vom Satellitenprovider an. Die digitale Kabelmodem-Technologie
nutzt das Fernseh-Kabelnetzkabel, an dem die Haushalte bereits angeschlossen
sind. Kabelmodem können Übertragungsraten über zehn Mbit/s
erreichen. Nach einer Prognose des Marktforschungsinstituts Kinetic Strategy
werden bis zum Jahre 2001 etwa 10 Millionen Kabelmodem installiert sein.
Mit neuen GSM-Standards für die Mobile Telephony, werden höhere Bandbreiten für mobile Kommunikation möglich. So plant NTT in Kooperation mit IBM, Matsushita und Sony digitale Musik auf dem Mobiltelefon anzubieten. Der Mobil-Telefonbesitzer wählt ein Musikstück und bekommt diese auf einen im Telefon eingebauten Sony-Memorystick überspielt. Die Musik kann er dann über das Telefon anhören oder den Memorystick herausnehmen und mit anderen digitalen Playern zusammen verwenden. Ein Pilotprojekt wird im April 2000 durchgeführt, um 2001 den mobilen digitalen Musikvertrieb anzubieten . Ähnliche Projekte plant Ericcson, zusammen mit Wysdom, die einen digitalen Music-Player mit integriertem Wideband-GSM-Empfänger entwickeln und Siemens, mit einem System für Video- und Musikübertragungen auf Mobiltelefone.
Neben der Entwicklung der zukünftigen Bandbreiten des Internetzugangs, sind die Online-Kosten und die Kosten für die Bereitstellung des Internetzugangs durch den Internet-Service-Provider zu betrachten. Die Online-Kosten sind bisher kontinuierlich gesunken. In Zukunft wird dieser Trend bestehen bleiben, wobei das Angebot der Internet-Service-Provider einen zeitlich unbegrenzten Internetzugang beinhalten wird (Flat-Rate). Dies würde die Kommunikationskosten beim digitalen Musikkauf weiter verringern. Höhere Bandbreiten und eine schnellere Übertragung der Musikdaten machen den digitalen Musikkauf interessanter und können die Etablierung des digitalen Musikvertriebes beim Musikkonsumenten weiter fördern.
4.5 Entwicklungsszenario der zukünftigen Nutzung digitaler Musik
Die Entwicklung und zukünftige Nutzung digitaler Musik könnte
sich in verschiedenen Stufen vollziehen:
Zur Zeit wird digitale Musik überwiegend am Computer genutzt und gespeichert. Zur Wiedergabe auf der Hifi-Anlage wird digitale Musik auf CD-R gebrannt. Mit Zunahme der Verfügbarkeit von digitaler Musik wird die Musiksammlung der Konsumenten zunehmend digitalisert und auf dem Computer gespeichert werden. Diese digitalisierte Musik wird am Computer, mit digitalen portablen und mit digitalen Hifi-Playern wiedergegeben. Sinkende Online-Kosten oder eine kostenlose Internetnutzung führen zu einer Nutzung von Musik direkt aus dem Internet, etwa in Form von Internetradio, direkte Musiküberspielung auf digitale Player oder die Wiedergabe von Musik aus Musikarchiven. Musikanbieter müssen digitale Musikdaten nach dem Musikverkauf nicht mehr übertragen, sondern erlauben einen Zugriff auf das Musikarchiv. Der kostenlose Musikanbieter MP3.COM bietet bereits die Option, statt die digitalen Musikstücke zu übertragen, sie in ein persönliches Musikverzeichnis eines kooperierenden Community- Server im Internet zu verschieben. Wenn keine Online-Kosten mehr bestehen und eine ausreichende Übertragungsrate (über 128kbps) für den Musikzugriff möglich ist, kann digitale Musik im Internet statt auf dem eigenen Rechner gelagert und gespeichert werden. Somit kann von überall im Internet auf die eigene Musik zugegriffen werden. Die Musik muß beim Musikverkauf prinzipiell nicht mehr dupliziert werden, sondern der Käufer erhält ein Zugriffsrecht auf die gekaufte oder je nach Business-Modell abonnierte Musikauswahl.
Eine völlige Substitution des Tonträgerhandels durch die digitale
Musikdistribution ist unwahrscheinlich. Nach L.Kenswil (Universal Music
Group) ist dies allein aufgrund der verfügbaren Bandbreiten des Internet
nicht möglich.Würde der gesamte CD -Verkauf einer Woche in US-Plattenläden
digital und über das Internet vollzogen, würden 250 Terrabyte
(bei 1:10 Kompression) Daten anfallen. Dies entspräche dem Datenaufkommen
des Internet in den USA in einer Woche.